|
|
|
| |
| |
|
Modul 1: Einführung in die Medienkulturwissenschaft |
| |
| |
|
Techniken des StudierensDozenten: Olivia Busse, Lisa Karst, M.A. Judith Pietreck Termin: Di 14-16 Uhr Ort: NP, Haus 9, Raum 2.04 SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 1 Pflichtveranstaltung: ja Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: Erstsemester (BA) Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Die Veranstaltung gibt einen Überblick über den Studiengang Europäische Medienwissenschaft sowie eine Einführung in die Techniken des Studierens. Ferner erfolgt eine Einführung zum wissenschaftlichen Arbeiten und Recherchieren. Eine Vertiefung erfolgt dann im nächsten Semester mit dem Seminar 'Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens'. Zusätzliche Informationen: Dies ist eine Pflichtveranstaltung für Erstsemester. Tragt euch bitte dennoch für diese Veranstaltung ein!
Testat: Exposé (1-2 Seiten) |
| |
| |
|
Vorlesung: Einführung in die MedienwissenschaftDozent: Prof. Dr. Kathrin Friedrich Termin: montags, 12-14 Uhr Ort: Neues Palais, 9.1.02 SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 1 Pflichtveranstaltung: ja Veranstaltungsart: Vorlesung Leistungspunkte: 1 Zielgruppe: 1. Semester Teilnehmerbegrenzung: 90 Beschreibung: Die Vorlesung bietet eine Einführung in das Fach Medienwissenschaft und einen Überblick über grundlegende Begriffe, Theorien sowie Problemfelder. Im Zentrum steht die Frage, wie Medien Wahrnehmen, Wissen und Handeln bedingen.
Zum Einstieg beschäftigen wir uns neben der Fachgeschichte zunächst mit grundlegenden Begriffen wie Medium, Medialität und Wissenschaft. Wie Medien die Wahrnehmung von etwas gleichermaßen ermöglichen und beschränken, besprechen wir anschließend am Beispiel von historischen und aktuellen Bildmedien. Dabei sind die Begriffe Technik, Ästhetik und Digitalität zentral. In den ersten Sitzungen geht es auch darum, unsere eigene Sichtweise auf Medien zu reflektieren und zu hinterfragen, wie individuelles und kollektives Wahrnehmen und Wissen geformt wird.
Danach stehen Kommunikation und Vermittlung in einer ‚Mediengesellschaft‘ im Zentrum. Am Beispiel von mobilen Medien, Apps und Plattformen besprechen wir, welche Ungleichheiten beim Konsum von Medien in ökologischer, infrastruktureller sowie sozio-kultureller Hinsicht auftreten. Die Grundlage hierfür bilden Debatten zu Medieninfrastrukturen, Öffentlichkeit und Partizipation. Dabei diskutieren wir auch, welche sozio-politische Rolle medienwissenschaftliche Theorie und Praxis in diesen Zusammenhängen einnimmt bzw. einnehmen könnte.
Im letzten Drittel der Vorlesung stehen neuere medienwissenschaftliche Problemfelder im Vordergrund. Mit den Schlagworten Sensormedien, Realitätsmedien und generative Bilder rückt die Handlungsdimension von Medien in den Vordergrund. Self-Tracking, immersive Virtual-Reality-Anwendungen oder KI-Bildgeneratoren fordern die medienwissenschaftliche Theoriebildung auf vielfältige Weise heraus. Wir setzen uns mit diesen Herausforderungen insbesondere in Bezug auf die Begriffe Normierung, Repräsentation und Operativität auseinander.
Zusätzliche Informationen: Für den Abschluss der Vorlesung ist kein Testat notwendig. Die Inhalte dieser Vorlesung sind zusammen mit denen der Vorlesung Medienkulturgeschichte die Grundlage für die Modulprüfungen. |
| |
| |
|
Seminar zur Vorlesung Einführung in die MedienwissenschaftDozent: Prof. Dr. Kathrin Friedrich Termin: donnerstags 10-12 Ort: Neues Palais, 9.2.04 SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 1 Pflichtveranstaltung: ja Veranstaltungsart: Seminar zur Vorlesung Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: 1. Semester BA Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: - Alle Materialien und aktuelle Termine für das Seminar finden sich in der virtuellen Lehre der Vorlesung!
Das Seminar ist als Begleitveranstaltung zur Vorlesung „Einführung in die Medienwissenschaft" konzipiert. Die Inhalte der Vorlesung werden jeweils durch die Diskussion eines verbindlich zu lesenden Texts vertieft. Auch Nachfragen zur Vorlesungssitzung können adressiert werden. Die Texte und die Arbeitsweise im Seminar werden zu Beginn genauer vorgestellt. Zusätzliche Informationen: Testat: Mündliche Stellungnahme zum Text (ca. 5 Minuten) |
| |
| |
|
Beiträge der MedientheorieDozent: Dr. Kai Knörr Termin: Di 12-14 Ort: Neues Palais, Haus 9, Raum 2.04 SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 1 Pflichtveranstaltung: ja Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: BA EMW (1. Semester) Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Innerhalb des obligatorischen Theorieseminars werden Texte zu medientheoretischen und medienhistorischen Fragestellungen gelesen.
Dies ist eine Pflichtveranstaltung für Erstemester. Einschreibung trotzdem notwendig!!!
Testat: Leseprotokoll 1-2 Seiten
Zusätzliche Informationen: Weiterführende Literatur: Helmes, Köster: Texte zur Medientheorie. Stuttgart, 2002. Pias et. al.: Kursbuch Medienkultur. München, 2008. Kümmel, Löffler: Medientheorie 1888-1933. Frankfurt a.M., 2002.
|
| |
| |
|
Modul 2: Technische und gestalterische Grundlagen digitaler Medien |
| |
| |
|
Technische und gestalterische Grundlagen digitaler Medien, Kurs ADozent: Torsten Schöbel Termin: Mittwoch, 10 – 13 Uhr Ort: FHP, LW-139 SWS: 4 Studiengang: BA Module (BA): 2 Pflichtveranstaltung: ja Veranstaltungsart: Projektseminar Leistungspunkte: 8 Zielgruppe: ausschließlich Studierende des 1. Semesters, Pflichtveranstaltung Teilnehmerbegrenzung: 15 Beschreibung: Der Kurs ist ein technisch-praktischer Grundlagenkurs, der sowohl technische und konzeptuelle Grundlagen im Bereich der digitalen Medien vermittelt als auch gestalterische Grundlagen und Konzepte der digitalen Medienproduktion.
Zusätzliche Informationen: Bitte beachten Sie, dass der Kurs ausschließlich eine Pflichtveranstaltung für BA-Erstsemester der EMW ist. Der Kurs ist obligatorisch und Voraussetzung für den Besuch der meisten weiteren Projektseminare sowie für den Zugang zum Computerlabor. Die Gruppe wird in drei Kurse geteilt. Bei der Einschreibung bitte nur für einen der drei Kurse (A, B oder C) entscheiden.
|
| |
| |
|
Technische und gestalterische Grundlagen digitaler Medien, Kurs BDozent: Torsten Schöbel Termin: Donnerstag 15 – 18 Uhr Ort: FHP, LW-139 SWS: 4 Studiengang: BA Module (BA): 2 Pflichtveranstaltung: ja Veranstaltungsart: Projektseminar Leistungspunkte: 8 Zielgruppe: ausschließlich Studierende des 1. Semesters, Pflichtveranstaltung Teilnehmerbegrenzung: 15 Beschreibung: Der Kurs ist ein technisch-praktischer Grundlagenkurs, der sowohl technische und konzeptuelle Grundlagen im Bereich der digitalen Medien vermittelt als auch gestalterische Grundlagen und Konzepte der digitalen Medienproduktion.
Zusätzliche Informationen: Bitte beachten Sie, dass der Kurs ausschließlich eine Pflichtveranstaltung für BA-Erstsemester der EMW ist. Der Kurs ist obligatorisch und Voraussetzung für den Besuch der meisten weiteren Projektseminare sowie für den Zugang zum Computerlabor. Die Gruppe wird in drei Kurse geteilt. Bei der Einschreibung bitte nur für einen der drei Kurse (A, B oder C) entscheiden.
|
| |
| |
|
Technische und gestalterische Grundlagen digitaler Medien, Kurs CDozent: Torsten Schöbel Termin: Freitag, 10 – 13 Uhr Ort: FHP, LW 139 SWS: 4 Studiengang: BA Module (BA): 2 Pflichtveranstaltung: ja Veranstaltungsart: Projektseminar Leistungspunkte: 8 Zielgruppe: ausschließlich Studierende des 1. Semesters, Pflichtveranstaltung Teilnehmerbegrenzung: 15 Beschreibung: Der Kurs ist ein technisch-praktischer Grundlagenkurs, der sowohl technische und konzeptuelle Grundlagen im Bereich der digitalen Medien vermittelt als auch gestalterische Grundlagen und Konzepte der digitalen Medienproduktion.
Zusätzliche Informationen: Bitte beachten Sie, dass der Kurs ausschließlich eine Pflichtveranstaltung für BA-Erstsemester der EMW ist. Der Kurs ist obligatorisch und Voraussetzung für den Besuch der meisten weiteren Projektseminare sowie für den Zugang zum Computerlabor. Die Gruppe wird in drei Kurse geteilt. Bei der Einschreibung bitte nur für einen der drei Kurse (A, B oder C) entscheiden. |
| |
| |
|
Modul 3: Medienrecht und Kulturökonomie |
| |
| |
|
Urheber-, Design- und Medienrecht im europäischen Kontext (Vorlesung mit integrierter Übung)Dozent: Prof. Dr. Nico Heise Termin: Dienstags, 10:00 bis 13:00 Uhr Ort: FH, D/011 SWS: 3 Studiengang: BA, MA Module (BA): 3 Module (MA): 8 Pflichtveranstaltung: ja Veranstaltungsart: Vorlesung Leistungspunkte: 3 Zielgruppe: empfohlen für BA 1. oder 2. Fachsemester Teilnehmerbegrenzung: 90 Beschreibung: Die Vorlesung behandelt die Grundzüge des Urheber-, Design-, Lizenz- und Äußerungsrechts im deutschen und im europäischen Kontext. Dazu gehören u.a. die Fragen, welche Werke urheberrechtlich geschützt sein können (z.B. Text, Fotografie, Film, bildende Kunst, Computerprogramme), wie ein Design eingetragen werden kann, wie lange der Schutz währt, wie Rechte lizensiert werden können und welche Möglichkeiten ein Rechteinhaber hat, gegen Rechtsverletzungen vorzugehen. Ein weiteres Thema der Vorlesung sind die Bedingungen und Limitierungen der (nicht nur journalistischen) Wort- und Bildberichterstattung. Besonders relevant sind dabei die unterschiedlichen Facetten des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Recht am eigenen Bild, Schutz der persönlichen Ehre) einschließlich des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung (Datenschutz). Neben den historischen und ökonomischen Hintergründen des Medienrechts werden wir insbesondere die großen Herausforderungen diskutieren, die sich aus der Entwicklung der digitalen Medien und des Internets für dieses Rechtsgebiet ergeben. Im Rahmen einer integrierten Übung werden wir das Gelernte anhand von praktischen Fällen trainieren. Zusätzliche Informationen: Abschluss: Klausur |
| |
| |
|
Medienrecht in Europa (Seminar)Dozent: Prof. Dr. Nico Heise Termin: Dienstags, 14:00-16:00 Ort: FH D/103 SWS: 2 Studiengang: BA, MA Module (BA): 3 Module (MA): 8 Pflichtveranstaltung: ja Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: ab 3. Semester Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Medien sind ubiquitär verfügbar und hatten noch nie die Eigenschaft, sich an politische Ländergrenzen zu halten. Dennoch wurde die Regulierung von Medien - mit einigen Ausnahmen - über Jahrhunderte weitgehend von nationalen Gesetzgebern dominiert. Seit einigen Jahren hat sich das Bild jedenfalls in Europa erheblich verändert. Mit der Datenschutzgrundverordnung (2016), der Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt (2019), der Regulierung der großen online-Plattform durch den Digital Services Act (2022) oder dem Versuch, die Entwicklung von KI-Anwendungen durch den AI-Act (2024) zu steuern, hat die Europäische Union sehr ambitionierte medienrechtliche Regelungen auf den Weg gebracht. Und mit dem Europäischen Rechtsakt zur Medienfreiheit (ebenfalls aus dem Jahr 2024) sollen Journalist*innen und Medienanbieter vor politischer Einflussnahme geschützt und Bürgerinnen und Bürgern ein freier und pluralistischer Zugang zu Informationen gewährleistet werden. Im Seminar werden wir diese Gesetzgebungsmaßnahmen im Rahmen von Referaten und Diskussionen erörtern und sie dabei - auch im Vergleich zu außer-europäischen regulatorischen Ansätzen - kritisch hinterfragen. Zusätzliche Informationen: Das Seminar schließt an die Vorlesung zum Urheber-, Design- und Medienrecht an und setzt eine erfolgreiche Teilnahme an dieser Vorlesung in einem der vorhergehenden Semester voraus.
Testat: Referat (10 Minuten) |
| |
| |
|
Der/die/das Fremde in Ausstellungen und MuseenDozent: Dr. Susanne Müller Termin: Mo 10-14 Ort: NP Haus 8 Raum 0.64 SWS: 4 Studiengang: BA Module (BA): 3 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Projektseminar Leistungspunkte: 5 Zielgruppe: BA EMW Teilnehmerbegrenzung: 15 Beschreibung: Museen und Ausstellungen sind traditionell (auch) ein Ort für die Inszenierung von Identität und Alterität. Auch wenn sich kaum ein Museum diesem Prinzip entziehen kann, gibt es Ausstellungen, die sich ausschließlich dem 'Anderen' und 'Fremden' widmen, wie z.B. ethnographische Dörfer, ethnologische bzw. Völkerkundemuseen, aber beispielsweise auch Zoologische Gärten. All diese Ausstellungsformen sind im 19. Jahrhundert entstanden und tragen ein kompliziertes Erbe, mit dem sie sich heute auseinandersetzen müssen.
In diesem Projektseminar wird es zunächst theoretisch um die Geschichte des Ausstellens, insbesondere um die Ausstellung des 'Fremden' gehen. In einem zweiten Schritt werden wir drei bis vier Ausstellungen/Museen besuchen und uns anschauen, wie der Blick auf das Andere und das Fremde heute erfolgt und wie die Ausstellungsorte mit ihrem (zum Teil wirklich komplizierten) Erbe umgehen. Um die Bandbreite möglichst groß zu halten, wird außerdem jede*r Teilnehmer*in eine thematisch passende (historische oder aktuelle) Ausstellung vorstellen. Schließlich soll in Arbeitsgruppen untersucht werden, wie ein zeitgemäßer Umgang mit dem 'Fremden' in Ausstellungen aussehen kann. Hierfür soll ein Konzept bzw. eine Projektidee entworfen werden.
Zusätzliche Informationen: Ort: Das Seminar findet am Neuen Palais statt oder in den jeweiligen Museen bzw. an Ausstellungsorten.
Zeit: Sofern die Öffnungszeiten es zulassen, finden alle Termine montags am Vormittag statt. Da viele Museen montags geschlossen sind, kann es sein, dass ein Museum selbstständig und außerhalb der Seminarzeiten besucht werden muss.
Testat: Referat |
| |
| |
|
Die Intelligenz des Kapitals: KI als Mythos, Metapher und MediumDozent: Prof. em. Dr. Michael Mayer Termin: Mi 14-18 Uhr, vierzehntägig, Beginn: 29.10.25 Ort: NP Haus 9, Raum 2.04 SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 3 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: BA EMW Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Nach dem Aufkommen eines massentauglichen Personal Computer (Anfang der 80er Jahre des 20. Jhr.), der Implementierung des World Wide Web (Anfang der 90er Jahre), dem Durchbruch von Social Media (Anfang der 2000er Jahre) und der weltweiten Distribution des Smartphone (ab den 10er Jahren des 21. Jhr.), scheint mit der Freischaltung von Chat-GPT (30.11.2022), einem frei zugänglichen, KI-basierten und generativen Textgenerierungsmodell eine neue Stufe in der Entwicklung der modernen Techo-Ökonomie erreicht worden zu sein. Flankiert wird sie durch aufgeregt hitzige Debatten wahlweise um die Möglichkeit einer Auslöschung der Menschheit oder der Lösbarkeit aller planetaren Krisen der Gegenwart, die besagte Menschheit zu verantworten habe. Ziel des Seminars wird sein, die dominierenden Diskurse zur Künstlichen Intelligenz zu entmythologisieren, indem wir erstens den Entstehungs- und Verwendungszusammenhang der Metaphern, die ihren Diskurs regulieren, hinterfragen, zweitens die spezifische, für ihre techno-ökonomische Verwertung zugerichtete Vorstellung von Intelligenz genealogisch kontextualisieren und drittens, indem wir KI als Medium begreifen, dessen Performativität bereits grundlegende Vorentscheidungen über das, was wir unter Intelligenz, Lernen, Kreativität, Urteilen etc. zu verstehen haben, getroffen hat.
Lit. Yuval Harari: Nexus (2024); Dieter Mersch: Kann KI Kunst? (2025); Käte Meyer-Drawe: Der Mensch in Spiegel seiner Maschinen (1996). Kate Crawford: Atlas der KI (2024); Manuela Lenzen: Künstliche Intelligenz (2020); Felix Maschewski, Anna-Verena Nosthoff: Künstliche Intelligenz (2024); Dies: Algorithmus (2024); James Muldoon (u.a.):Feeding the Machine (2024); Jan Distelmeyer: Mit der KI zu tun bekommen (2025); Martin Gessmann: Das Lächeln der Roboter (2020); Isaac Asimov, I Robot (1950); Harlan Ellison, I have no Mouth and I must Scream (1967). E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann (1816).
Zusätzliche Informationen: Für den Erwerb der Credits (Testat) muss ein Protokoll (ca. zwei Seiten) angefertigt und vorgestellt werden. Die Einzelheiten besprechen wir in der ersten Sitzung. |
| |
| |
|
Modul 4: Europäische Kulturgeschichte und Medienkulturgeschichte |
| |
| |
|
Zwischen Schreibmaschine und Filmkamera (Konferenz)Dozent: Prof. Dr. Jan Distelmeyer Termin: 19.-23. November Ort: Gästehaus der Universität Hamburg SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 4 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Seminar (Exkursion) Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: BA Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Beim Blick auf die literarische Szene der 1950er – 1980er Jahre in West- und Ost-Deutschland, ergibt sich ein erstaunlicher Unterschied. In der DDR arbeiteten viele führende Schriftsteller*innen auch selbst im Film: Christa & Gerhard Wolf schrieben Drehbücher, Helga Schütz war u.a. Studentin an der Filmhochschule in Babelsberg, Jurek Beckers Welterfolg »Jakob der Lügner« begann als Drehbuch. Dagegen war für die meisten westdeutschen Autor*innen das Kino offensichtlich ein »noli me tangere« – abgesehen davon, wenn sie ihre Bücher für die Verfilmung durch andere freigaben.
Das CineFest 2025 und der begleitende Internationale Filmhistorische Kongress wird den gesellschaftlichen Gründen und kulturellen Auswirkungen dieser Situation nachgehen. Dazu kommen Rückblicke zur Situation in vorherigen Epochen, z.B. dass der expressionistische Dichter Franz Richard Behrens als Erwin Gepard Drehbücher (1920 HAMLET mit Asta Nielsen) und Filmkritiken schrieb. Bei den Nazis unerwünschte Schriftsteller (Edlef Köppen) kamen in der Filmindustrie unter. Führende HJ-Filmer wie Alfred Weidenmann und Herbert Reinecker (JUNGE ADLER, 1943/44) konnten in der BRD unangefochten weiterarbeiten (DER STERN VON AFRIKA, 1956/57; DERRICK).
Diese uns weitere Fragen werden beim XXII. cinefest und dem 38. Internationalen Filmhistorischen Kongress behandelt.
Zusätzliche Informationen: Dieses Seminar wird in Verbindung mit dem Seminar "Zwischen Schreibmaschine und Filmkamera" (Filme) angeboten.
Es legt den Schwerpunkt auf Texte und Vorträge zu diesem Teil der europäischen Mediengeschichte und findet als Exkursion in Hamburg (im Rahmen der Kooperation mit CineGraph – Hamburgisches Centrum für Filmforschung und dem Bundesarchiv-Filmarchiv, Berlin) statt. Hier werden wir an dem 38. Internationalen Filmhistorischen Kongress teilnehmen, der in das Internationale Festival des deutschen Film-Erbes (CineFest) eingebettet ist. Zusätzlich zu Vorträgen und Diskussionen prägen darum Filmvorführungen und -gespräche vor Ort die Exkursion.
Zusätzlich zur Exkursion sind weitere Sitzungen (zur Einführung und Nachbereitung) verpflichtend.
Termin des Vorbereitungstreffens: 30.10., 16:30 Uhr
Termin des Nachbereitungstreffens: 28.1., 14:00 Uhr
Die ermäßigten Kosten für die Teilnahme an allen Film- und Vortrags-Veranstaltungen im Rahmen des Festivals und Kongresses betragen 39 Euro.
Testat: Zusammenfassung für das Nachbereitungstreffen (Umfang ca. 2 Seiten) |
| |
| |
|
Zwischen Schreibmaschine und Filmkamera (Filme)Dozent: Prof. Dr. Jan Distelmeyer Termin: 19.-23. November Ort: Gästehaus der Universität Hamburg SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 4 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Seminar (Exkursion) Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: BA Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Beim Blick auf die literarische Szene der 1950er – 1980er Jahre in West- und Ost-Deutschland, ergibt sich ein erstaunlicher Unterschied. In der DDR arbeiteten viele führende Schriftsteller*innen auch selbst im Film: Christa & Gerhard Wolf schrieben Drehbücher, Helga Schütz war u.a. Studentin an der Filmhochschule in Babelsberg, Jurek Beckers Welterfolg »Jakob der Lügner« begann als Drehbuch. Dagegen war für die meisten westdeutschen Autor*innen das Kino offensichtlich ein »noli me tangere« – abgesehen davon, wenn sie ihre Bücher für die Verfilmung durch andere freigaben.
Das CineFest 2025 und der begleitende Internationale Filmhistorische Kongress wird den gesellschaftlichen Gründen und kulturellen Auswirkungen dieser Situation nachgehen. Dazu kommen Rückblicke zur Situation in vorherigen Epochen, z.B. dass der expressionistische Dichter Franz Richard Behrens als Erwin Gepard Drehbücher (1920 HAMLET mit Asta Nielsen) und Filmkritiken schrieb. Bei den Nazis unerwünschte Schriftsteller (Edlef Köppen) kamen in der Filmindustrie unter. Führende HJ-Filmer wie Alfred Weidenmann und Herbert Reinecker (JUNGE ADLER, 1943/44) konnten in der BRD unangefochten weiterarbeiten (DER STERN VON AFRIKA, 1956/57; DERRICK).
Diese uns weitere Fragen werden beim XXII. cinefest und dem 38. Internationalen Filmhistorischen Kongress behandelt.
Zusätzliche Informationen: Dieses Seminar wird in Verbindung mit dem Seminar "Zwischen Schreibmaschine und Filmkamera" (Konferenz) angeboten.
Es legt den Schwerpunkt auf Filmbeispiele zu diesem Teil der europäischen Mediengeschichte und findet als Exkursion in Hamburg (im Rahmen der Kooperation mit CineGraph – Hamburgisches Centrum für Filmforschung und dem Bundesarchiv-Filmarchiv, Berlin) statt. Hier werden wir an dem 38. Internationalen Filmhistorischen Kongress teilnehmen, der in das Internationale Festival des deutschen Film-Erbes (CineFest) eingebettet ist. Zusätzlich zu Vorträgen und Diskussionen prägen darum Filmvorführungen und -gespräche vor Ort die Exkursion.
Zusätzlich zur Exkursion sind weitere Sitzungen (zur Einführung und Nachbereitung) verpflichtend.
Termin des Vorbereitungstreffens: 30.10., 16:30 Uhr
Termin des Nachbereitungstreffens: 28.1., 14 Uhr
Die ermäßigten Kosten für die Teilnahme an allen Film- und Vortrags-Veranstaltungen im Rahmen des Festivals und Kongresses betragen 39 Euro.
Testat: Zusammenfassung für das Nachbereitungstreffen (Umfang ca. 2 Seiten) |
| |
| |
|
Unter Null - Geschichte der künstlichen KälteDozent: Dr. Kai Knörr Termin: Do 14-16 Ort: NP 1.09.2.04 SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 4 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: S Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: BA-EMW Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Das Seminar rekonstruiert eine Kultur- und Mediengeschichte der künstlichen Kälte. Das Themenspektrum reicht vom Eishandel im 18. und 19. Jahrhundert, der Technikgeschichte der Kältemaschine, der Geschichte des Speiseeises bis hin zu popkulturellen Diskursen über Kälte in der Literatur, 'coolness' bis hin zur heutigen Klimadebatte und der Zukunft der Raumklimatisierung. Es geht um Sicht- und Unsichtbarkeit aktueller und historischer Infrastrukturen, um z.T. abseitige Zukunfts- und Jenseitsvorstellungen, um die Toleranzbereiche von Umwelt und Lebensbedingungen. Geplant sind ggf. zwei Exkursionen an spannende Orte zum Thema in Berlin/Potsdam. Zusätzliche Informationen: Testat: Referat 10-15 Min. |
| |
| |
|
Europäische KulturgeschichteDozent: Prof. Dr. Heiko Christians Termin: Die Vorlesung findet montags von 16:15 bis 17:45 am NP statt Ort: Neues Palais, Haus 9, Raum 1.02 SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 4 Pflichtveranstaltung: ja Veranstaltungsart: Vorlesung Leistungspunkte: 3 Zielgruppe: 1. Semester Teilnehmerbegrenzung: 90 Beschreibung: Die Vorlesung führt in die Europäische Kulturgeschichte ein. Im Vordergrund stehen Fragen der technischen, politischen und künstlerischen Infrastrukturen. Zunächst wird das politische Projekt 'Europa' in der Gegenwart und seine Geschichte erläutert. Es folgen methodische Anmerkungen zur 'Infrastrukturgeschichte' und zum 'kulturellen Feld'. Dann werden systematisch und chronologisch Orte und Städte vorgestellt, die als Ausgangspunkt europaweit wirksamer Innovationen anzusehen sind. Das betrifft die Bereiche Politik, Verkehr, Kunst oder Religion. So ergibt sich - beginnend mit den klassischen Orten Athen (Demokratie) und Rom (Imperium) - eine Karte aus unterschiedlichen, aber aufeinander folgenden 'kulturellen Feldern' und zeitlich begrenzten Einflussgebieten. |
| |
| |
|
Europäische Kulturgeschichte (Seminar zur Vorlesung)Dozent: Prof. Dr. Heiko Christians Termin: Die Übung findet donnerstags von 12-14 Uhr am NP statt Ort: Neues Palais, Haus 9, Raum 2.04 SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 4 Pflichtveranstaltung: ja Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: 1. Fachsemester Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Die Veranstaltung vertieft spezifische Inhalte der Pflicht-Vorlesung Europäische Kulturgeschichte.
Zusätzliche Informationen: Testat: Reading Response 2 Seiten |
| |
| |
|
Medienmogule, Tech-Milliadäre und die amerikanische Technokratie-Bewegung. Eine medienwissenschaftliche SpurensucheDozent: Prof. Dr. Heiko Christians Termin: Das Seminar findet mittwochs von 12-14 Uhr am NP statt Ort: Neues Palais, Haus 9, Raum 2.04 SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 4 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: BA Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Das Seminar versucht die aktuelle politische Weltlage dem Wissen der Medienwissenschaft wenigstens ein bisschen zugänglicher zu machen. Was kann man beobachten, wenn man seine Meinung/ Gesinnung/ Überzeugung etwas weniger in den Vordergrund rückt und auf ‚Wissenschaft‘ setzt – so zweifelhaft und angefochten dieses Konzept von Wissen auch wirken mag im Moment? Fest steht: (Gemeinsame) Empörung stärkt zwar den Gruppenzusammenhalt, ist aber noch keine intellektuelle Leistung. Um eine kognitive Leistung oberhalb bzw. unterhalb von Empörung oder moralischer Selbstgewissheit, immer schon auf der richtigen Seite zu stehen, abrufbar zu machen, muss man sich zunächst verunsichern lassen können. Das geht auch, indem man medienwissenschaftliches Vokabular zwischenschaltet. Mein Angebot wäre es, gemeinsam zu beobachten, wie verschiedene Medienformate und –figuren so hochskaliert werden, dass sie globale Politik (-formate) werden, die sich in ihrer Logik der Vorstellungskraft von NationalbürgerInnen nahezu entziehen. In Martin Heideggers ‚Abendgespräch in einem Kriegsgefangenenlager‘ von 1945 klingt das so: „Das Nationale bleibt auch dort maßgebend, wo sich Nationen auf das Internationale einigen.“ Einerseits gab es im Politischen schon immer Größenunterschiede, andererseits können so neue Konzepte entstehen. Verkleinerung und Vergrößerung bieten Möglichkeiten. Was das Imperium vom Nationalstaat unterscheidet, ist so eine (schon ältere) Frage. Das Imperium ist einfach ein anderes (und wesentlich älteres) Format von (Außen-)Politik als der Nationalstaat oder ein Bund aus Nationalstaaten. Das Agieren Russlands, Chinas und der USA ist unter diesem Gesichtspunkt besser zu beobachten. Zu ihrem Auftreten und ihrer inneren Logik gehören seit einiger Zeit UnternehmerInnen-Figuren (Oligarchen, Tycoone, Tech-Milliadäre, Staatsunternehmer), die ihre Unternehmungen global adressieren. Was ist ein Tycoon, der vom All träumt, gegenüber einem Medienunternehmer, der ein paar Mehrheitsanteile an Firmenkonglomeraten in Deutschland und Italien hält? [Hier eine Liste mit ‚Tycoonen‘ und eine kleine Wortgeschichte: https://de.wikipedia.org/wiki/Tycoon] Filmklassiker wie ‚Aviator‘ oder ‚Citizen Kane‘ haben sie schon längst für spannende küchenpsychologische Porträts (Bio-Pics) entdeckt.
Wie beschreibt man Unternehmer, die globale ‚Ideen‘ haben, die weit über das Geschäftliche hinausreichen? Unternehmer, die sich selbst einer ‚Bewegung‘ zurechnen, der sogenannten ‚Technokratiebewegung‘, über die wir so gut wie nichts wissen. Noch einmal: Ganz offensichtlich reden wir auch über hochskalierte Formate und Figuren. Sie machen gerade vielen Angst. Ein Grund mehr, sie mit kühlem Kopf zu betrachten. Das Beispiel Amerikas ist hierbei das Populärste. Zum Seminar gehört es deshalb, die politischen und technologischen, aber auch geopolitischen Parameter dieses Landes zunächst ein wenig anschaulicher zu machen, sozusagen das Spielbrett beschreiben, auf dem die Akteure dann hoffentlich besser zu verstehen sind. Da ich den Begriff ‚Wissenschaft‘ mit nicht mehr allzu großer Selbstverständlichkeit benutzt habe, will ich eine Definition anbieten, mit der sich arbeiten ließe: „Wissenschaften sind ‚systematische Gewebe von Begründungen‘. Es liegt in ihnen eine ‚Begründung des Wissens und gehörige Verknüpfung und Ordnung in der Folge der Begründungen‘.“ [M. Heidegger]
Erste Literaturhinweise: Karl Schlögel, American Matrix. Besichtigung einer Epoche, München (2023); Thomas P. Hughes, Die Erfindung Amerikas. Der technologische Aufstieg der USA seit 1870, München (1991); Werner Link, Die Vereinigten Staaten von Amerika und Europa. Owen D. Young und das amerikanische Europa-Engagement in den 20er Jahren, in: August Nitschke et al. (Hg.), Jahrhundertwende. Der Aufbruch in die Moderne 1880 – 1930, Reinbek b. Hamburg (1990), Bd.1, S.434 – 461; Stefan Willeke, Die Technokratiebewegung in Nordamerika und Deutschland zwischen den Weltkriegen, Frankfurt/M. (1995); Jill Lepore, Diese Wahrheiten. Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika, München, 6. Aufl. (2021).
Zusätzliche Informationen: Testat: Inhaltsangabe zu einem Titel der angegebenen Literatur im Umfang von 2 Seiten |
| |
| |
|
Modul 5: Medienkunst |
| |
| |
|
Zeitgenössische Kunst - Ausstellungen, Institutionen, Diskurse IIDozent: Prof. Winfried Gerling Termin: Do. 11:30 - 13:30 Ort: FHP D116/Ausstellungshäuser in Berlin SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 5 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 2 CP Zielgruppe: fortgeschrittene BA-Studierende Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: In dieser Veranstaltung werden wir jede Woche ein oder zwei Ausstellungen besuchen. Jeder Besuch wird von einem Team Studierender vorbereitet und mit einer kurzen Präsentation eingeleitet (Testat). Zur Vorbereitung eines Besuchs gehört es Artikel/Material zur Ausstellung zu sammeln, Kontakt zur Institution (Galerist*innen, Kurator*innen, Direktor*innen, Künstler*innen etc.) aufzunehmen und wenn möglich dafür zu sorgen, dass es ein Gespräch in der Ausstellung gibt. Es geht darum aktuelle Kunst-Diskurse, Formen von Ausstellungen und unterschiedliche Institutionen kennenzulernen. Der inhaltliche Schwerpunkt wird auf Fotografie, Video und Medienkunst liegen. Zusätzliche Informationen: Wer diesen Kurs belegt, muss auch den zweiten Kurs dazu belegen: Zeitgenössische Kunst - Ausstellungen, Institutionen, Diskurse I.
Testat: Referat zur besuchten Instiution. (10 min) |
| |
| |
|
Opazität als Widerstand in aktueller Video- und Performancekunst (revisited)Dozent: Karin Michalski Termin: Projektwoche 17.-21.11. (tägl. 10-17 Uhr), 27.10. (16-17 Uhr via Zoom) Ort: Kunstorte in Berlin (u.a. Gropius Bau, Haus am Waldsee, JSC Collection) SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 5 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: B.A. 2. Sem. Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Die Produktion von Forschung und Wissen ist in (post-)kolonialen Verhältnissen oft geprägt von sozialen und materiellen Hierarchien. Der französische Philosoph Édouard Glissant fordert daher ein Recht auf Opazität ein, das Recht, nicht verstanden zu werden, und stellt sich gegen den Anspruch auf allumfassende Transparenz. Für wissenschaftliche und auch künstlerische Projekte stellt sich die Frage, welche Ausdrucksformen dieses Recht auf „opacity“ annehmen könnte. Dieses Seminar fragt u.a. nach der Aktualität von Glissants Ansätzen.
Fragen, die uns auch beschäftigen werden: wie gehen Kunstorte (deren Leitungen und Kurator*innen) mit der aktuellen politischen Situation um? Welche Vorstellungen haben wir von Kunstorten und wie würden wir uns selber darin gerne sehen? (siehe auch Andrea Geyers Manifest und die partizipatorische Performance "I Want" 2024 im Gropius Bau). Wir werden zudem Ausstellungen u.a. von Beverly Buchanan/Haus am Waldsee, Diane Arbus, Ligia Lewis/Gropius Bau, Mark Leckey/Julia Stoschek Collection, Jeremy Shaw/Hamburger Bahnhof,"Museum in Bewegung: Eine Sammlung für das 21. Jahrhundert" besuchen. Zusätzliche Informationen: Nach Anmeldung zum Seminar werden genauere Angaben zum Seminarplan via Mail verschickt.
Englischkenntnisse sind Voraussetzung für die Teilnahme am Seminar, da die Texte und Video-Beispiele zumeist in englisch sein werden.
Testat: Referat (10 min.)
|
| |
| |
|
[In]tangible mediaDozent: M.A. Anna Zaglyadnova Termin: Mo, 14-16 Ort: UP NP, 8.0.59 SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 5 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Leistungspunkte: 2 Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Medienkunst wird meist als ästhetische Arbeit mit elektronischen und digitalen Medien verstanden. Dabei ist es wichtig zu begreifen, dass Medien eine Bedingung aller Kunstformen sind. Um Kunst kommunizieren zu können, benötigen wir ein Medium, unabhängig von der Kunstform. Ein Kunstwerk entsteht in einem bestimmten sozialen, politischen und kulturellen Kontext und kommuniziert diesen, macht ihn greifbar, was durch seine mediale Ausprägung unterstrichen wird. Im Kunstkontext spricht man daher von Kunstwerken als „tangible art“ (greifbare Kunst).
Doch wie genau können wir diese Greifbarkeit verstehen? Welche Rolle spielt die (physische) Form in einem Kunstwerk? Gerade digitale Medien stellen diese Frage auf neue Weise: Wie kann Digitalität greifbar gemacht werden? Ist digitale Kunst auch greifbare Kunst? Das Seminar setzt sich mit dem Konzept der „Tangible Media“ im Kontext der Kunst auseinander und erörtert die Frage nach der Grenze zwischen Greifbarem und Ungreifbarem. Wie wird das Ungreifbare begriffen? Welche Rolle spielt dabei ein Medium? Wie verhalten sich Form, Inhalt und Medium zueinander? Im Rahmen des Seminars beschäftigen wir uns mit den Themen der Physikalität, Digitalität, Medialität, sensorischen Wahrnehmung und ihren Einordnungen im Rahmen der künstlerischen Praxis.
Zusätzliche Informationen: Testat: Referat (10 Min) |
| |
| |
|
Games ArtDozent: M.A. Anna Zaglyadnova Termin: Di, 10-12 Ort: UP, NP 9.2.04 SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 5 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Leistungspunkte: 2 Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Digitale Spiele sind längst zu einem zentralen Medium der Gegenwartskultur geworden. Die Computerspiele inspirierten eine ganze Gattung der Medienkunst, die sich ihrer Ästhetik, Form und Inhalt bedient. Spannend an Games Art ist die Tatsache, dass sie sowohl digitale als auch analoge Ausdrucksformen kennt (vgl. Invader) und sowohl in digitalen als auch physischen Räumen ausgestellt wird.
Im Mittelpunkt des Seminars steht die Frage, wie Künstler:innen das Medium Spiel für künstlerische Experimente, ästhetische Reflexionen und gesellschaftliche Kommentare nutzen. Theoretisch bewegt sich das Seminar an der Schnittstelle von Medientheorie, Kunst- und Kulturwissenschaften sowie Game Studies. Ausgehend von der historischen Entwicklung der Medienkunst diskutieren wir, wie sich digitale Spiele als Material und Methode für künstlerische Ausdrucksformen etabliert haben.
Zusätzliche Informationen: Testat: Referat (10 Min) |
| |
| |
|
Zeitgenössische Kunst - Ausstellungen, Institutionen, Diskurse IDozent: Prof. Winfried Gerling Termin: Do. 10:00 - 11:30 Ort: FHP D116/Ausstellungshäuser SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 5 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 2 CP Zielgruppe: fortgeschrittene BA-Studierende Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: In dieser Veranstaltung werden wir jede Woche ein oder zwei Ausstellungen besuchen. Jeder Besuch wird von einem Team Studierender vorbereitet und mit einer kurzen Präsentation eingeleitet (Testat). Zur Vorbereitung eines Besuchs gehört es Artikel/Material zur Ausstellung zu sammeln, Kontakt zur Institution (Galerist*innen, Kurator*innen, Direktor*innen, Künstler*innen etc.) aufzunehmen und wenn möglich dafür zu sorgen, dass es ein Gespräch in der Ausstellung gibt. Es geht darum aktuelle Kunst-Diskurse, Formen von Ausstellungen und unterschiedliche Institutionen kennenzulernen. Der inhaltliche Schwerpunkt wird auf Fotografie, Video und Medienkunst liegen.
--- Zusätzliche Informationen: Wer diesen Kurs belegt, muss auch den zweiten Kurs dazu belegen: Zeitgenössische Kunst - Ausstellungen, Institutionen, Diskurse II.
Das erste Treffen findet in der FH statt.
Wenn möglich wird eine Exkursion nach Hamburg Bestandteil der Veranstaltung sein.
Testat: Referat zur besuchten Instiution. (10 min) |
| |
| |
|
Modul 6: Theorien, Formen und Geschichten des Wissens |
| |
| |
|
Vorlesung MedienästhetikDozent: Prof. Dr. Birgit Schneider Termin: mittwochs, 10-12 Uhr Ort: Neues Palais Raum 9.1.02 SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 6 Pflichtveranstaltung: ja Veranstaltungsart: Vorlesung Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: BA-Studierende im 3. Semester Teilnehmerbegrenzung: 90 Beschreibung: Die Medienästhetik-Vorlesung stellt die Ästhetik im Sinne der Aisthesis ins Zentrum – also als Lehre von der sinnlichen Wahrnehmung. Diese wird anhand von zentralen Begriffen wie Mimesis, Simulation, Schein, Immersion, Aura und Atmosphäre sowie technisches Sensing entfaltet, Begriffe, die für viele Fragen der Medienwissenschaft zentral sind. Wir nehmen aber auch Konzepte wie virtuelle Umwelten und den Begriff des environments in den Blick und Fragen nach der Ästhetik spezifischer Medien von Panorama bis zum Smart Phone. In jeder Woche befassen wir uns anhand von Primärtexten mit Autor:innen, die hierzu einschlägig publiziert haben. Im Zentrum steht die Frage, wie Umwelten wahrgenommen werden und was geschieht, wenn diese Wahrnehmung medial und technisch aufgerüstet wird durch Prothesen, Linsen, Kameras, Lautsprecher, Projektionen, Head Mounted Displays oder Go-Pro-Kameras. Die Vorlesung wird dabei Schlaglichter der Theorie praxisnah anhand von zahlreichen einschlägigen, aber auch randständigen Beispielen aus allen Bereichen der Kunst entfalten. Zusätzliche Informationen: Zusätzliche Informationen:
Zu der Vorlesung gibt es ein Seminar. Beide Veranstaltungen sind für die Studierenden des 3. Semesters verpflichtend.
Abschluss: Klausur. |
| |
| |
|
Medienästhetik (Seminar zur Vorlesung)Dozent: M.A. Alexander Schindler Termin: Mi 12:15-13:45 Ort: NP 8.0.59 SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 6 Pflichtveranstaltung: ja Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: 3. Semester EMW B.A. Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: In diesem Seminar lesen und diskutieren wir klassische Texte zur Medienästhetik und besprechen Beispiele begleitend zur Vorlesung und Klausur Medienästhetik.
Das Seminar ist daher als laufende Übung für die Klausur Medienästhetik im BA-Modul 6 zu verstehen.
Themen sind dabei das Schöne und das Erhabene (Immanuel Kant), physiologische und technologische Bedingungen sinnlicher Wahrnehmung (Jonathan Crary), Mimesis (Walter Benjamin), Aura (Walter Benjamin), Simulation (Jean Baudrillard), Immersion (Robin Curtis), Technisches Bild (Vilém Flusser), Atmosphäre (Gernot Böhme), mediale Umwelten (Marshall McLuhan), Programmieren von Umgebungen (Jennifer Gabrys).
Wichtige organisatorische Details und Vorbereitungstätigkeiten folgen in der Platzannahme-Mail.
Zusätzliche Informationen: Testat: Referat (10 min) |
| |
| |
|
(Umkämpftes) Wissen – am Beispiel von Wikipedia als kollaborativem Raum für Wissen im NetzDozent: Prof. Dr. Birgit Schneider Termin: montags 16-18 Uhr Ort: Neues Palais – 8.0.59 SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 6 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: BA-Studierende Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: In einer Zeit, in der die Unterschiede zwischen Fakten und Fake News aktiv verwischt werden und KI und Soziale Medien die Vermittlung von Wissen zunehmend übernehmen, widmet sich das Seminar dem Begriff des Wissens. Was ist Wissen, wie und wer erzeugt dieses, wie wird dieses bewahrt, was ist sein Verhältnis zur Wahrheit und wie hat sich Wissen historisch entwickelt? Um Wissen in all seinen Facetten zu verstehen, werden wir uns im Seminar nicht nur mit den Wissensbegriffen, sondern auch mit den Praktiken des Wissens befassen, indem wir fragen, wie Wissen entsteht und wie es sich historisch und vor allem durch neue Technologien verändert hat.
Als zentrales Beispiel dient dem Seminar hierzu die 2001 gegründete Plattform Wikipedia, die nach dem Wiki-Prinzip und auf der Grundlage von freiwilligen Mitschreibenden als Enzyklopädie funktioniert. In einem Teil des Seminars werden wir grundlegende Texte zum Wissensbegriff und zu Wissensordnungen lesen sowie die historischen Vorläufer von Wikipedia kennenlernen. In einem zweiten Teil – und auch gleich zu Beginn – werden wir uns intensiv praktisch mit Wikipedia beschäftigen – also mit einer Plattform, die von vielen Seiten bedroht ist. Dazu werden wir ausgewählte Seiten selbst verändern, erstellen, schreiben bzw. ergänzen und so das Prinzip hinter den Einträgen von Wikipedia kennenlernen. Das Seminar beinhaltet also das Schreiben von Texten für eine Wissensplattform wie Wikipedia. Methodisch wird das Seminar zwischen Lehrforschungseinheiten, praktischen Übungen und begrifflichen Klärungen und Diskussionen wechseln. Außerdem ist geplant, Gäste einzuladen.
Zur Vorbereitung empfehle ich den mehrteiligen Podcast "Sockenpuppenzoo", den Sie in der ARD-Audiothek finden. Und natürlich Wikipedia. Zusätzliche Informationen: Testat: Erstellung eines Wikipedia-Eintrags (2 Seiten) |
| |
| |
|
Projektwoche: Natur, Macht und Geschichte Dozenten: Dr. Lisa Cronjäger, Prof. Dr. Birgit Schneider Termin: während der Projektwoche 17.-21.11.25 Ort: Berlin SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 6 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Projektseminar mit Exkursionsanteil Leistungspunkte: 2 Teilnehmerbegrenzung: keine Beschreibung: Die Projektwoche wird von Dr. Lisa Cronjäger (Basel) mit geleitet. Es findet im Rahmen und in Kooperation mit der Ausstellung Natur und deutsche Geschichte. Glaube – Biologie – Macht (14. November 2025 bis 7. Juni 2026) im Deutschen Historischen Museum statt. Zudem werden weitere thematisch passende Exkursionsorte, vornehmlich in Berlin, einbezogen (Archive, Umweltbibliotheken).
Thema des Seminars sind Naturbegriffe, Naturbilder und Naturvorstellungen in historischer und aktueller Perspektive, die wir auf Fragen des Ausstellens beziehen. Wir werden dabei nicht nur die Umweltgeschichte mit einbeziehen, sondern auch ökofeministische Ansätze kennenlernen und dabei immer im Blick haben, mit welchen Medien Naturvorstellungen verknüpft sind.
Da dieses Seminar ein Blockseminar ist, das davon lebt, dass sich alle Teilnehmenden die Zeit nehmen, das gesamte Seminar zu besuchen, bitte ich Sie sich nur anzumelden, wenn Sie sich die Woche über für das Seminar freinehmen können von anderen Verpflichtungen. (Mo 10-16 Uhr, Di 10-16 Uhr, Mi 10-14 Uhr, Do 10-16 Uhr, Fr 10-13 Uhr).
Zur Vorbereitung werden allen TN ausgewählte Texte zugeteilt. Bitte lest die Texte besonders genau im Hinblick auf Naturvorstellungen und erstellt einen ersten Entwurf für eure reading response. Zusätzliche Informationen: Testat: Reading Response (3 Seiten) (Abgabe 28.2.2026, erster Entwurf: 17.11.2025) |
| |
| |
|
Ordnen, Vergessen, Erinnern und Sorgen. Kritische Perspektiven auf KolonialarchiveDozent: Jakob Claus Termin: montags zweiwöchentlich 14-18 Uhr Ort: Uni Potsdam, Neues Palais, Haus 8, Raum 0.64 SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 6, 10 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: BA-Studierende Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Wenn koloniale Archive und Depots als machtvolle Wissensspeicher einer Gesellschaft verstanden werden, stellt sich die grundlegende Frage, wer sie organisiert, nach welchen Prinzipien dies geschieht und was sie bewahren. Diese Institutionen sind nicht nur Orte, an denen tradierte Ordnungsstrukturen, Erinnerungskulturen und Wissenssysteme fortwirken, sondern auch Räume, in denen alltägliche Praktiken, kollektives Gedächtnis und Wissen anhand von medialen Objekten wie Fotografien, Dokumenten, Ton- und Filmaufnahmen der (deutschen) Kolonialgeschichte stabilisiert werden.
Neben den aktuell oft im öffentlichen Fokus stehenden musealen Sammlungen kultureller Objekte, umfassen Kolonialarchive auch umfangreiche fotografische und phonographische Bestände. Diese medialen Objekte bringen jeweils eigene Geschichten ihrer technischen Bedingungen mit sich und werfen spezifische Fragen nach ihrer kritischen und dekolonialen Aufarbeitung auf. Welche Wissensordnungen und Machtverhältnisse zeigen sich anhand kolonialer Fotografien und Tonaufnahmen? Inwiefern bestimmen (historische) Medientechniken die Logik von Archiven? Was erzählen und verschweigen die Archive, was machen sie sicht- und hörbar? Inwiefern fordert die zunehmende Digitalisierung der Bestände einen verantwortungsvollen und sorgenden Umgang mit der gewaltvollen Geschichte? Und wie lassen sich mediale Kolonialarchive auch als Ort kritischer Interventionen und dekolonialer Geschichte verstehen?
Im Seminar werden wir neben einführenden Theorien und Ansätzen zu Archiven ebenso Perspektiven auf Kolonialarchive und Ambivalenzen der Digitalisierung entwickeln. Dafür setzen wir uns exemplarisch mit fotografischen und phonographischen Archiven auseinander und erörtern die Frage, wie ein verantwortungsvoller Umgang und kritische Aufarbeitung medialer Archive aussehen können.
Zusätzliche Informationen: Das Seminar findet 14-täglich als Doppelsitzung statt.
Bereitschaft zur Lektüre englischer Texte wird vorrausgesetzt. |
| |
| |
|
Neue Soziale Ungleichheit: Fragen zu Bildung, Medien und DemokratieDozent: M.A. Alexander Schindler Termin: 17.11.-21.11.; 10-17h + Zoom-Vorbreitung: tba Ort: NP, Mo-Mi: 08.0.58, Do-Fr: 08.0.56 SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 6 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Blockseminar Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: BA Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Entgegen den anhaltenden Erzählungen eines stets wachsenden und sich immer breiter verteilenden Wohlstands, kann seit mehr als zwei Jahrzehnten ein neues Maß an sozialer Ungleichheit beobachtet werden, das sich durch bestehende soziologische Erklärungsmodelle nur schwer fassen lässt. Aus der so genannten Leistungsgesellschaft (‚Meritokratie‘) und ihrem zentralen Versprechen eines sozialen Aufstiegs durch Bildung und beruflichen Fleiß für jede/n, hat sich u.a. Deutschland zu einer Gesellschaft entwickelt, in der strukturelle soziale Ungleichheiten zunehmend reproduziert werden. Soziale Mobilität – das meritokratische Kernargument – wird statistisch gesehen zur Ausnahme.
Was insbesondere deutsche Soziologen (es waren dies ausschließlich männliche Autoren) der 1980er mit dem Individualisierungstheorem oder der Aufstiegsgesellschaft beschrieben und damit einen endlos fahrenden „sozialen Fahrstuhl“ figurierten, der alle gleichsam nach oben bringt, wird seit einigen Jahren einer überfälligen Revision unterzogen. Die ‚Abstiegsgesellschaft‘ Deutschlands (Nachtwey) und die globalen Analysen neuer ‚Ungleichheitsregime‘ (Piketty) sind dabei nur zwei der zahlreichen Konzepte in einer nun wachsenden Landschaft der Ungleichheitsforschung. Einigkeit herrscht hier darüber, dass die soziale Herkunft (‚Klassenhintergrund‘) wieder zu einem der zentralen Marker für die individuellen Chancen in einer Gesellschaft wurde.
In diesem Blockseminar plus Vorbereitungszeit per Zoom (!) widmen wir uns diesen Entwicklungen gemeinsam und in Arbeitsgruppen, in dem wir sie anhand von drei, eng verbundenen, Bereichen betrachten: Bildungschancen und -klassismus; mediale Repräsentation von sozialer Ungleichheit; Gegenwart von Demokratie und Partizipation.
Details zum Ablauf, insbesondere der Gruppeneinteilung und der Vorbereitungsarbeiten, werden noch bekannt gegeben. Zusätzliche Informationen: Testat: Referat (10 min) |
| |
| |
|
Modul 7: Mediale Inszenierungsformen |
| |
| |
|
Flow! Analysen von SpielkulturenDozent: Michael Liebe Termin: Fr., 14-16 Uhr Ort: FHP D 116 SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 7 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: BA Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Spielen gehört zum Menschsein, zum Lernen und Erkunden. Mit dem Aufkommen von Computerspielen wurde Spiel intensiv aus verschiedenen Perspektiven und mit unterschiedlichen Theorien erforscht. Im Seminar untersuchen wir die Motivation in ein Spiel einzusteigen und weiter zu spielen. Die Flowtheorie bietet dazu einen produktiven Ansatz, der es nicht nur erlaubt, verschiedene Computerspielformen - wie Single Player Spiele, kompetetive Multiplayer Spiele, free to play Mobile Games, oder Brettspiele und Sportspiele - zu vergleichen, sondern auch Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit anderen Unterhaltungsmedien, wie TV- und Radio-Programm, oder eben mit Serien-Binge-Watching. Im Seminar untersuchen wir, wie Flow in verschiedenen Spieltypen funktioniert und welche Rolle Aufgaben, Herausforderungen und Messbarkeit von Performance in der Spielkultur einnehmen und welchen Einfluss Flow auf Gamedesign, Geschäftsmodelle und die Rezeption von Spielen haben. Zusätzliche Informationen: Testat: Präsentation von 15 Minuten, mit PowerPoint oder ähnlichem sowie Frage und Antwort mit Gruppe |
| |
| |
|
The Revolution WILL... Happen, Be Televised, Performed, Documented ...Dozent: Simon-Mary Vincent Termin: Mi 10:00 - 13:00, 14-tägig, Beginn: 22.10.2025 Ort: FHP D 119 SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 7 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: BA Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: “The Revolution will not be televised …”
Gil Scott-Heron
“Music is the weapon.”
Fela Kuti
“Q: If February is Black History Month and March is Women’s History Month, what happens the rest of the year?
A: Discrimination.”
GUERILLA GIRLS’ POP QUIZ
Gil Scott-Herons gesprochene Worte sagten der Welt, dass die Revolution nicht im Fernsehen übertragen wird. Sie wird nicht einfach eine Wiederholung im Fernsehen sein, unterbrochen von den Botschaften der Konzernsponsoren, sondern sie wird live sein.
In diesem Seminar werden die Begriffe Protest, Counter-Culture und Revolution unter dem Gesichtspunkt des künstlerischen und weiter gefassten soziokulturellen, soziopolitischen Ausdrucks betrachtet und die Frage gestellt: Wie sehen Protest, Counter-Culture und Revolution aus? Wie klingen sie? In welchen Rahmen, auf welchen "Bühnen" und in welchen "Arenen" artikulieren sie sich und welche Formen nehmen sie an?
Am Beispiel von Yoko Ono, Gil Scott-Heron, Fela Kuti, den Guerilla Girls, Pussy Riot, Joan Baez, Nina Simone, Kneecap, Acid House und anderen werden diese Fragen anhand von Werken, Ansätzen, Strategien und größeren Zusammenhängen untersucht.
Ein Felasophisches Treffen im Haus der Kulturen der Welt am 15. Oktober bietet eine interessante Einführung in das Seminar.
https://www.hkw.de/programme/a-felasophical-gathering#main
Wichtiger Hinweis: Dieses Seminar findet alle 2 Wochen statt.
Zusätzliche Informationen: Testat: Essay (3 Seiten) zu einem der im Seminar diskutierten Themen. |
| |
| |
|
Questioning the convention: game design as (eco-)critical practice Dozent: Saskia Joanna Rauhut Termin: Mi, 14-16 Uhr Ort: FHP D 105 SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 7 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: BA Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: This course combines theoretical analysis with practical design work, using perspectives from game studies and game design. We will focus on the way videogames present the "natural" environment and its relationship to humans. We will discuss different aspects of videogames, such as the behavior of the gameworld, the presentation of information about the gameworld, and actions available to the player – inquiring how ideas and world views can find their ways into design decisions. Theoretical analysis will be complemented by practical work where we engage with different digital and physical materials to prototype alternatives to existing game design conventions.
The course will be taught in English.
Requirements:
- Interest in videogames: being an experienced gamer is absolutely not a requirement, but you should be curious about videogames and willing to play and discuss selected games.
- Interest in both theoretical and practical work: you should be willing to read academic texts AND get your hands dirty (literally, as we will sometimes be using physical materials for prototyping). Zusätzliche Informationen: Testat: Individual presentation (10 mins).
Each student gives a 10-min presentation (of which 7 mins are for the presentation itself, and 3 mins are for Q&A). The task is to present a videogame of your choice and to offer a brief analysis of selected design aspects using the lenses introduced in class.
You can find the link to the sign-up list below. Please sign up for one time slot by Dec 14.
INFO: No class on Nov 19 due to project week. Instead, we will hold an additional session on Feb 11. |
| |
| |
|
Orte der Rundfunk- und Podcast-Geschichte (Projektwoche)Dozent: Dr. Kai Knörr Termin: Projektwoche 17.11.-21.11.2025 Ort: FHP Audiolabor/ Exkursionen SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 7 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: BA-EMW Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Nach einem einführenden Tag in Potsdam besuchen wir ausgewählte Orte der Rundfunk- und Podcastgeschichte in und um Berlin. Im Gespräch mit Personen aus Vermittlung und Praxis soll ein Verständnis über die so unterschiedlichen Produktionskulturen des akustischen Erzählens, vom Sendesaal bis zum Wohnzimmerstudio, gewonnen werden. Zusätzliche Informationen: Testat: Gruppenreferat 10 min. |
| |
| |
|
NintendoDozent: Ugur Yildirim Termin: Freitag 14-18 Uhr, 14-tägig Ort: NP 9.2.04 SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 7 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: BA Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: NINTENDO
Das Seminar widmet sich der japanischen Firma Nintendo, die weltweit für ihre Videospiele und Spielkonsolen bekannt ist. Kultfiguren wie Donkey Kong, Mario, Zelda oder Pikachu gehören längst zur globalen Popkultur und feiern auch jenseits der Spieleindustrie große Erfolge.
Im Zentrum des Seminars steht das Thema Retro Gaming. Besonders das Spiel Wii Sports (Resort), das häufig als eines der besten Sportspiele der Konsolengeschichte bezeichnet wird, dient als Beispiel: In Gruppenarbeit wird es regelmäßig gespielt, reflektiert und analysiert.
Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit der Verfilmung von Videospielen. Gezeigt und diskutiert werden u. a. die Kinofilme Super Mario Bros. (1993) sowie Der Super Mario Bros. Film (2023).
Ein Exkursionsbesuch ins Videospielmuseum Hannover ist ebenfalls geplant. Zusätzliche Informationen: Testat: Referat von 15 Minuten zu einer Sportdisziplin aus Wii Sports Resort |
| |
| |
|
Modul 8: Konzepte und Formen der Mediengestaltung |
| |
| |
|
Experimentelle AnimationsfilmeDozent: Torsten Schöbel Termin: Dienstag 10:00 – 16:30 Uhr Ort: FHP LW 139 SWS: 8 Studiengang: BA Module (BA): 8 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: P Leistungspunkte: 12 Zielgruppe: BA Teilnehmerbegrenzung: 15 Beschreibung: Im Projektseminar werden die praktischen und technischen Grundlagen digitaler Mediengestaltung vermittelt, mit besonderem Schwerpunkt auf Animation, Compositing und Sound. Ziel ist es, diese Fähigkeiten in einen diskursiven Kontext zu stellen und zu künstlerisch-medienreflexiven Experimenten im Rahmen eines übergeordneten Themas weiterzuentwickeln. Die Möglichkeiten sind dabei vielfältig: Schrift, Bild- und Tonmaterialien können in konzeptuelle Beziehungen zueinander gesetzt und in neue Sinnzusammenhänge transformiert werden. Das Spektrum reicht von der Bearbeitung, Kombination und Animation bewegter und statischer Bilder, Grafiken, Fotografien, Texte, Buchstaben, Klänge und Töne bis hin zu deren Arrangement im zwei- oder dreidimensionalen Raum. Im Zentrum steht eine künstlerische und wissenschaftliche Medienpraxis, die sich mit räumlichen und zeitlichen Wahrnehmungsdimensionen sowie unterschiedlichen Formen des Denkens auseinandersetzt. Das Seminar schließt mit einer eigenständigen, künstlerisch-medienreflexiven Projektarbeit, in der die theoretischen und praktischen Erkenntnisse in einem kohärenten, experimentellen Werk zusammenführt werden.
Zusätzliche Informationen: Die Prüfungsleistung umfasst eine 10-minütige Präsentation und Dokumentation von Arbeitsergebnissen sowie eine medienreflexive/künstlerische Projektarbeit. |
| |
| |
|
Konzept- und Projektentwicklung: Digital Storytelling & Serious GamesDozent: Christina Maria Schollerer Termin: Do, 06.11.: 16:00-18:00 Uhr; Projektwoche 17.-21.11.: täglich 10:00-17:00 Uhr Ort: FHP D103 (Kick-Off) & D116 (Projektwoche) SWS: 4 Studiengang: BA Module (BA): 8 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: P Leistungspunkte: 6 Zielgruppe: vorrangig 3. Semester Teilnehmerbegrenzung: 15 Beschreibung: Egal ob im fiktionalen, journalistischen oder dokumentarischen Kontext: Wir sind umgeben von digitalen Storytelling-Formaten und interaktiven Erzählwelten. Auch Serious Games – Spiele, die Wissen, Haltung oder gesellschaftliche Themen vermitteln – greifen auf narrative Strukturen zurück, um komplexe Inhalte erlebbar zu machen.
Doch wie entwickelt man ein solches Projekt von der ersten Idee bis zum pitch-fertigen Konzept? Welche Faktoren sind entscheidend bei der Konzeption und Projektplanung?
Das Projektseminar vermittelt Grundkenntnisse in den Techniken und Strukturen der Konzept- und Projektentwicklung mit dem Ziel, eigene Ideen zu entwickeln und zu präsentieren. Der Fokus liegt auf der Erarbeitung von digitalen Storytelling-Formaten und Serious-Games-Konzepten im Team. Neben einer Einführung in die Konzeption und der Analyse bestehender Beispiele gibt das Seminar Einblicke in Zielgruppenorientierung, Plattformstrategien, sowie grundlegende Aspekte von Zeit-, Personal- und Finanzplanung. Abgeschlossen wird das Seminar mit der Präsentation eines eigenen Digital-Storytelling- bzw. Serious-Game-Konzepts.
Zusätzliche Informationen: Die Veranstaltung endet mit der 10-minütigen Präsentation eines eigenen Serious-Game-Konzepts.
Achtung:
Das Seminar beginnt am Donnerstag, den 06.11.2025 um 16:00-18:00 Uhr mit einem Kick-Off-Termin und der Einführung ins Thema und die Recherchephase. Die Teilnahme am Kick-Off-Termin ist Voraussetzung für die erfolgreiche Teilnahme am Seminar.
Danach erfolgt der Unterricht innerhalb der Projektwoche täglich 10:00-17:00 Uhr an der FHP in Raum D 116.
Christina Maria Schollerer ist Gründerin des Berliner StoryDesign.Studios und Kuratorin und Leiterin des Wettbewerbs für Interaktives & Digitales Storytelling beim Deutschen Kinder Medien Festival Goldener Spatz. |
| |
| |
|
Modul 9: Mediale Projekte |
| |
| |
|
Gesellschaft gestalten – Partizipative TV-Formate als MedienpraxisDozenten: Markus Sorychta, Dr. Katrin von Kap-herr Termin: Mo 10:15-13:45 Ort: FHP D 103 SWS: 4 Studiengang: BA Module (BA): 9 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Projektseminar Leistungspunkte: 4 Zielgruppe: BA Teilnehmerbegrenzung: 15 Beschreibung: Nach den ausgestrahlten TV-Talkbox-Sendungen im Frühjahr und Sommer 2025 bei ALEX Berlin starten wir in eine neue Runde: Aufbauend auf den aktuellen Aussagen aus der Talkbox-Tour 2025 in Berlin und Brandenburg, die im Sommersemester konzipiert wurde, entsteht erneut eine mehrteilige Talkshow.
Im Mittelpunkt stehen authentische Aussagen von Bürger*innen, die sich zu verschiedenen gesellschaftlich relevanten Themen geäußert haben. Ihre Stimmen bilden die Grundlage für die redaktionelle Arbeit und die inhaltliche Gestaltung im Seminar.
Das Seminar bietet praxisnahe Einblicke in alle Bereiche der Fernsehproduktion – von der Idee bis zur fertigen Sendung. Die Teilnehmenden schlüpfen dabei in wechselnde Rollen wie Redaktion, Moderation, Interview, Kamera oder Aufnahmeleitung. Unterstützt durch Workshops und professionelle Technik entstehen mehrere Talkshows, die gesellschaftliche Themen aufgreifen, unterschiedliche Perspektiven sichtbar machen und zeigen, wie partizipative Medienarbeit heute funktionieren kann. Zusätzliche Informationen: Dieses Projektseminar richtet sich an Studierende, die ihre theoretischen Kenntnisse durch die praktische Arbeit an einem TV-Format vertiefen möchten. Vorkenntnisse in der Medienproduktion sowie der Besuch des Seminars im Sommersemester sind von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich. Das Seminar findet in Kooperation mit ALEX Berlin statt. |
| |
| |
|
Radio-Baukasten RetroMedia - Medienexperimente an der Analog-Digital-SchwelleDozent: Dr. Kai Knörr Termin: Fr 10-17 Ort: FHP Audiolabor SWS: 8 Studiengang: BA Module (BA): 9 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Projektseminar Leistungspunkte: 8 Zielgruppe: ab BA 3. Semester Teilnehmerbegrenzung: 15 Beschreibung: Im Projektseminar untersuchen und experimentieren Sie ausführlich mit Soundmaterial, Sie erschließen beim Abhören und Montieren im Audiolabor grundlegendes Technikwissen und charakteristische Ausdrucksmittel akustischen Erzählens. Wir reflektieren gemeinsam Alltagsformen akustischer Medien (Radio, Podcast, Audiowalk). Ein Schwerpunkt kann diesmal auf den spielerisch-experimentellen Einsatz von historischem Digital- und Analog-Equipment gelegt werden. Es besteht die Möglichkeit der gemeinsamen Gestaltung einer europaweit empfangbaren Radio-Kurzwellen-Sendung in Kooperation mit dem Funkerberg-Radio Königs Wusterhausen. |
| |
| |
|
Experimentelle FotografieDozent: Céline Pilch Termin: Fr. 13:00 - 16:30 Ort: FHP D 103 SWS: 4 Studiengang: BA Module (BA): 9 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: P Leistungspunkte: 4 Zielgruppe: BA/MA Teilnehmerbegrenzung: 15 Beschreibung: Das Seminar ist künstlerisch praktisch ausgelegt und bietet eine Einführung in die analoge Fotografie. Ihr werdet sowohl die technischen Aspekte wie Bildwinkel, Blendenöffnung und Belichtungszeit als auch die chemischen Grundlagen wie Entwicklungszeiten und den Umgang mit Chemikalien kennenlernen.
Im Laufe des Semesters werden verschiedene Techniken eingeführt, um schließlich eigene Projekte zu entwickeln. Der Fokus liegt auf dem Experiment und dem Zusammenspiel von chemischen Reaktionen und Licht. Wir werden Kameras bauen, lichtempfindliche Oberflächen erzeugen, und Abzüge von digitalen Bildschirmen entwickeln. Mit Zeit und Neugier gilt es, die verschiedenen Prozesse zu erkunden und die gestalterischen Möglichkeiten der experimentellen Fotografie für eigene Ideen zu nutzen.
Außerdem sprechen wir über die Entstehungsgeschichte der Fotografie und den Unterschied zwischen analogen und digitalen Bildern. Das Wesen des Mediums, seine transformativen Eigenschaften und sein Einfluss auf unsere Wahrnehmung werden diskutiert und in der praktischen Arbeit erfahrbar gemacht.
Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
Für Chemikalien und Fotopapier fallen Materialkosten von 10€ an, die zu Beginn des Semesters bezahlt werden können. |
| |
| |
|
Modul 10: Interdisziplinäres Ergänzungsstudium |
| |
| |
|
TheaterkritikDozenten: M.A. Judith Pietreck, Christian Rakow Termin: Do 10-14 Uhr (14-tägig) Ort: ZeM (Hermann-Elflein-Straße 18, 14467 Potsdam) SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 10 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: BA Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Das Seminar führt in die Analyse zeitgenössischer Theaterarbeiten ein und stellt das journalistische Genre der "Theaterkritik" vor. Es werden Perspektiven auf den Wandel der Theatersprachen erarbeitet und theoretischen Grundlage der Inszenierungsanalyse erarbeitet. Gemeinsame Theaterbesuche sollen uns die Möglichkeit bieten, die erlernten Analyseinstrumente unmittelbar an konkreten Beispielen zu erproben. Regelmäßige Schreibübungen im Seminar sorgen dafür, dass Theorie und Praxis eng verzahnt sind und die Teilnehmenden eigene Formen kritischer Reflexion entwickeln können. |
| |
| |
|
Ordnen, Vergessen, Erinnern und Sorgen. Kritische Perspektiven auf KolonialarchiveDozent: Jakob Claus Termin: montags zweiwöchentlich 14-18 Uhr Ort: Uni Potsdam, Neues Palais, Haus 8, Raum 0.64 SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 6, 10 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: BA-Studierende Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Wenn koloniale Archive und Depots als machtvolle Wissensspeicher einer Gesellschaft verstanden werden, stellt sich die grundlegende Frage, wer sie organisiert, nach welchen Prinzipien dies geschieht und was sie bewahren. Diese Institutionen sind nicht nur Orte, an denen tradierte Ordnungsstrukturen, Erinnerungskulturen und Wissenssysteme fortwirken, sondern auch Räume, in denen alltägliche Praktiken, kollektives Gedächtnis und Wissen anhand von medialen Objekten wie Fotografien, Dokumenten, Ton- und Filmaufnahmen der (deutschen) Kolonialgeschichte stabilisiert werden.
Neben den aktuell oft im öffentlichen Fokus stehenden musealen Sammlungen kultureller Objekte, umfassen Kolonialarchive auch umfangreiche fotografische und phonographische Bestände. Diese medialen Objekte bringen jeweils eigene Geschichten ihrer technischen Bedingungen mit sich und werfen spezifische Fragen nach ihrer kritischen und dekolonialen Aufarbeitung auf. Welche Wissensordnungen und Machtverhältnisse zeigen sich anhand kolonialer Fotografien und Tonaufnahmen? Inwiefern bestimmen (historische) Medientechniken die Logik von Archiven? Was erzählen und verschweigen die Archive, was machen sie sicht- und hörbar? Inwiefern fordert die zunehmende Digitalisierung der Bestände einen verantwortungsvollen und sorgenden Umgang mit der gewaltvollen Geschichte? Und wie lassen sich mediale Kolonialarchive auch als Ort kritischer Interventionen und dekolonialer Geschichte verstehen?
Im Seminar werden wir neben einführenden Theorien und Ansätzen zu Archiven ebenso Perspektiven auf Kolonialarchive und Ambivalenzen der Digitalisierung entwickeln. Dafür setzen wir uns exemplarisch mit fotografischen und phonographischen Archiven auseinander und erörtern die Frage, wie ein verantwortungsvoller Umgang und kritische Aufarbeitung medialer Archive aussehen können.
Zusätzliche Informationen: Das Seminar findet 14-täglich als Doppelsitzung statt.
Bereitschaft zur Lektüre englischer Texte wird vorrausgesetzt. |
| |
| |
|
Vibe Coding: KI-gestützte App-Entwicklung jenseits klassischer ProgrammierungDozenten: Prof. Dr. Jan Distelmeyer, Pascal Kienast Termin: Dienstags, 16-18 Uhr (c.t.) Ort: FHP D103 SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 10 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 2 ECTS Zielgruppe: BA Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Ein paar Abende Arbeit und fertig ist die eigene App – ganz ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Was nach Science Fiction klingt, ist 2025 bereits Realität. Immer mehr Menschen nutzen KI-Tools, um in Minuten Websites zu bauen, Games zu entwickeln oder Apps zu programmieren. Man beschreibt der KI einfach die Idee, und die Maschine erledigt den Rest. "Vibe Coding" nennt sich dieses Phänomen – man gibt sich den "Vibes" hin, vergisst dass Code überhaupt existiert, und lässt die KI die Arbeit machen.
Funktioniert das wirklich? Oder ist das nur Marketing-Hype? Welche Grenzen gibt es? In diesem Seminar werden wir diese Fragen praktisch testen und erkunden die neue Welt der KI-gestützten Entwicklung mit Tools wie Cursor, Lovable, Claude Code usw. Wir werden selbst zu "Vibe Codern" und entwickeln eigene digitale Projekte – von interaktiven Websites über experimentelle Games bis hin zu eigenen Apps, die anschließend im App-Store veröffentlicht werden können.
Dabei merken wir schnell: Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Doch was bedeutet es für unsere Medienkompetenz, wenn Software zur Black Box wird und niemand mehr versteht, wie der Code funktioniert? Welche Sicherheitsrisiken entstehen? Wer trägt die Verantwortung für Fehler? Und was bedeutet diese Entwicklung für die Zukunft kreativer Berufe?
Das Seminar verbindet hands-on Workshops mit medientheoretischer Reflexion. Am Ende entwickeln alle Teilnehmenden in Kleingruppen ein eigenes digitales Artefakt – ganz ohne traditionelle Programmierkenntnisse, aber mit kritischem Bewusstsein für die Chancen und Grenzen dieser neuen Technologie.
Zusätzliche Informationen: Wir werden ausschließlich mit kostenlos verfügbaren KI-Tools experimentieren. Um sinnvoll an diesem Seminar teilzunehmen, ist es jedoch wichtig, dafür offen zu sein, KI-Tools zu nutzen, die ggf. nicht allen Datenschutzanforderungen der Universität Potsdam entsprechen.
Testat: Projektpräsentation (10-15 Min.)
Keine Programmierkenntnisse erforderlich!
|
| |
| |
|
Abstraction Today: The Real and the ImaginaryDozent: Dr. Svea Bräunert Termin: Di, 18:15 – 19:45 Ort: Online SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 10 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Ring-VL Leistungspunkte: 2 Teilnehmerbegrenzung: 90 Beschreibung: From automated navigation to weather forecasts, data visualizations, and painting, abstraction has an undeniable presence in the contemporary world. Yet, it not only represents but also creates worlds. It is an operative concept that likewise possesses an imaginary thrust for perceiving things otherwise. As such, abstraction comes in many different forms: It is an aesthetic, a technology, an epistemology, and a practice. Therefore, it is also a political attitude, a mode of description, a tool of complexity reduction, and an instruction for intervention. Depending on its context and use, it can take on radically different connotations, ranging from dehumanizing to appealing, from affirmative to critical, from incorporated to autonomous.
Taking its cue from the different meanings and applications of abstraction, the international lecture series “Abstraction Today: The Real and the Imaginary” is designed as an interdisciplinary endeavor with a focus on visual media and digital culture. Most digital technologies (like networks, computer simulation or artificial intelligence) and correlated practices are closely connected to different forms of abstraction on different levels. To do justice to the complexity of the phenomenon, the series brings together a group of international scholars, artists, and curators who speak on abstraction today as it unfolds in fields such as art, photography, film, design, image science, visual culture studies, philosophy, and more. Grounding the inquiries into the contemporary conditions of abstraction are contributions focusing on its historical lineage, most importantly its emergence within the discourse of modernism to be understood in its global and postcolonial plurality.
With Presentations by Kim Albrecht, Crystal Campbell, Sabine Eckmann, Henning Engelke, David Getsy, Till Heilmann, Evan Hume, Razvan Ion, Sven Luetticken, Birgit Schneider, Alberto Toscano, Isabel Wünsche.
Zusätzliche Informationen: The international lecture series is co-organized by the Brandenburg Center for Media Studies and the University of Bonn (Media Studies & Art History). It takes place online.
You can find the full program here: https://www.medienwissenschaft.uni-bonn.de/lehrveranstaltungen/abstraction-today-1
EMW students can enroll in the lecture series as part of "Modul 10: Interdisziplinäres Ergänzungsstudium." They will be asked to write a three-page essay in response to one of the lectures. Also, there will be three check-in dates to talk about the presentations. These check-ins will take place online on October 21 (organizational questions), January 6, and February 3.
|
| |
| |
|
Black Box: Future Love Dozent: Prof. Myriel Milicevic Termin: Di 10-15:30 Ort: FH LW226 SWS: 6 Studiengang: BA, MA Module (BA): 10 Module (MA): 8 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Projektseminar Leistungspunkte: 4 Zielgruppe: Design, offen für EMW Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Liebe ist eine zentrale menschliche Erfahrung – und eine wirkmächtige: Viele wichtige Denker*innen haben Liebe als die transformative Kraft beschrieben, um gesellschaftliche Unterdrückungsstrukturen und andere Missstände zu beenden und positive Veränderungen in der Gesellschaft zu erreichen. Somit ist Liebe nicht nur eine Erfahrung, sondern vor allem eine Praktik (“love is a verb”), die mit Verantwortung einhergeht und damit auch gestaltbar ist. Die Liebe in ihrer großen Vielfalt ist im Wandel: z.B. prägen gesellschaftliche Phänomene wie Patriarchat, Globalisierung oder Kapitalismus, digitale Medien, globale Krisen und neue Familien- und Beziehungsmodelle, wie wir Menschen uns selbst wahrnehmen und wie wir zu anderen Menschen und nicht zuletzt auch zu nicht-menschlichen Lebewesen in Beziehung treten.
Wir bringen dieses Thema in die öffentliche Diskussion. Gemeinsam gestalten wir im Kurs eine mehrdimensionale öffentliche Intervention, die Menschen anregt darüber nachzudenken, welche Formen von Liebe sie selbst, und wir als Gesellschaft, in Zukunft wie leben könnten, wollen, oder nicht (mehr) wollen.
Dazu werden wir eine erfahrbare, sprichwörtlich begreifbare oder begehbare Intervention erschaffen, die Besucher*innen einlädt, spielerisch und reflektierend über dieses Thema nachzudenken. In Teamarbeit entwickeln wir „Black Boxes“ die metaphorisch für die Offenheit der Zukunft stehen und als interaktive Ausstellungsexponate – im besten Fall mobil und selbsterklärend/autark in der Nutzung – überraschen, erleuchten, informieren und zum Diskurs anregen.
Jede “Box” wird eine spezifische Form von Liebe repräsentieren - etwa Selbstliebe, Freund*innenschaft, Romantik, familiäre Liebe, Liebe zu Mitmenschen oder Liebe zur Natur. Körperlichkeit und Sexualität kann, muss aber nicht, dabei in all diesen Formen von Liebe als Querschnittsthema vorkommen. All diese Boxen werden über ihre individuellen Formate Menschen auf unterschiedliche Weise dazu anregen, neue eigene Visionen zur Liebe in der Zukunft auszuformulieren und sie kritisch zu reflektieren. Um dies zu erreichen, folgen wir dem vielfach erprobten Ansatz der „Xtopie“, die als Interventionskonzept inhaltlich auf die Ambivalenzen zwischen utopischen und dystopischen Zukunftsvorstellungen fokussiert und so Kontroversen und Dialog stimulieren kann (siehe xtopien.org).
Sie selbst werden das Tool sein oder beherbergen verschiedene interaktive Tools, Bildungsformate, Spiele oder andere Anregungen. Die Black Boxes variieren in Form, Größe, Haptik oder Materialität und stehen damit auch für die Vielfalt möglicher Zukünfte.
Wie sich die Boxen konkret entfalten, kann vieles sein. Sie können sowohl selbst den Interaktionsraum bilden oder dreidimensionale spekulative Objekte als Impulsgeber für Diskussionen über mögliche Zukünfte u.v.m. beinhalten. Denkbar sind auch beispielsweise digitale Tools wie QR Codes zu interaktiven Webseiten, Befragungstools, Perspektivwechsel-Spiele, Audiofiles, oder Anleitungen zu Selbstexperimenten.
Der Kurs umfasst ernsthaftes wie humorvolles, experimentelles wie kommunikatives, prozesshaftes wie ergebnisorientiertes Arbeiten. In verschiedenen Übungen werden wir unser Vorstellungsvermögen trainieren, Ideen iterieren, Themen eigenständig recherchieren, Bilder und Geschichten und partizipative Formate entwickeln, Modelle und Prototypen bauen, testen, realisieren und schließlich auch evaluieren.
Die Intervention erfolgt mit einem Praxispartner in Berlin.
Zusätzliche Informationen: !!!Anmeldung über Incom: https://fhp.incom.org/workspace/11384 |
| |
| |
|
Schlaf-Wandel Dozent: Prof. Myriel Milicevic Termin: Mo 10-15:30 Ort: FHP D105 SWS: 6 Studiengang: BA, MA Module (BA): 10 Module (MA): 8 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Projektseminar Leistungspunkte: 4 Zielgruppe: Design, offen für EMW Teilnehmerbegrenzung: keine Beschreibung: Gestaltung und Inszenierung von Schlaf-Mode, um auf Schlafen als un/gerechten Zustand aufmerksam zu machen.
Alles Leben kennt und braucht Ruhephasen – gerade auch in Großstädten wie Berlin. Was bedeutet „Schlafen“ im urbanen Raum für Menschen, Tiere, Pflanzen? Welche Auswirkungen haben zunehmende Hitze, helle Nächte, Luftverschmutzung oder unterschiedliche soziale Verhältnisse auf Schlaf, und damit auf das Wohlbefinden, die Gesundheit und die Lebensbedingungen aller Stadt-Lebewesen? Gibt es ein Umweltrecht auf Schlafen? Welche Umweltbedingungen ermöglichen oder verhindern erholsamen Schlaf in der Stadt? Und wie kann Gestaltung dazu beitragen, neue Sichtweisen auf dieses existenzielle Thema zu eröffnen?
In diesem Kurs setzen wir uns mit dem Recht auf Schlaf nicht nur aus der Sicht von Menschen, sondern auch aus einer More-than-Human-Perspektive auseinander. Nacht- und Tagschlafende, aber auch Winterschlafende und zwischendurch Ruhende leiden unter Umweltstress oder müssen sich anpassen: Verdunklung und Ohrstöpsel, nachts aufstehen und vor dem anschwellenden Verkehrslärm singen, oder Jagdzeiten verlegen sind nur einige Hilfsmaßnahmen. Die aus Stadtspaziergängen, Selbstexperimenten, Perspektivwechsel, wissenschaftlichen Recherchen und Inputs gewonnenen Erkenntnisse werden infografisch übersetzt, und Pyjamas, Nachthemden und sonstige Schlafwäsche als „Deklaration für Schlaf-Wandel“ gestaltet, um auf die Thematik aufmerksam zu machen. Die Schlaf-Wandel-Mode wird fotografisch im öffentlichen Raum inszeniert und dokumentiert und ggf. als Ausstellung präsentiert.
Die Wäsche wird mit einfachen Mitteln vor allem unter Aspekten von Reuse und Recycling von Materialien gefertigt. Vorkenntnisse im Nähen und Schneidern sind toll, aber keine Voraussetzung.
Der Kurs wird fachlich begleitet und findet in Kooperation mit Dr. Kim Mortega, Museum für Naturkunde Berlin und Herbert Lohner, BUND Berlin statt.
„Schlaf-Wandel“ knüpft an den Projektwochen-Kurs „Schlafen in der Stadt. Mapping eines un/gerechten Zustands“ an. Die Kurse können aber unabhängig voneinander belegt werden.
Zusätzliche Informationen: !!!! Achtung: Anmeldung über Incom
https://fhp.incom.org/workspace/11354 |
| |
| |
|
Modul 11: Freie Projektarbeit (betreut) |
| |
| |
|
Printmagazin "Seitenspiel"Dozenten: Prof. Dr. Heiko Christians, Torsten Schöbel Termin: TBA Ort: TBA SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 11 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Freies Projekt Leistungspunkte: 10 Zielgruppe: BA-EMW Teilnehmerbegrenzung: 5 Beschreibung: Ziel ist die Fortführung des Projektes "Seitenspiel" als graphisch und inhaltlich anspruchsvolles Printmagazin für die Studierenden der Europäischen Medienwissenschaft. Nach Übergabe durch die Redaktion der letzten Nummer bildet sich ein neues Redaktionsteam, das unter inhaltlicher Betreuung und Budgetplanung seine eigenen Themenschwerpunkte und Gestaltungsideen umsetzen kann.
Zusätzliche Informationen: Bitte setzen Sie sich rechzeitig mit einem der Lehrenden in Verbindung. Die Anmeldung für die freie Projektarbeit bzw. Mitarbeit im neuen Redaktionsteam findet zum Wintersemester statt. Die Projektzeit verteilt sich auf das WS und SoSe. |
| |
| |
|
LAN-PartyDozent: M.A. Anna Zaglyadnova Termin: Mo, 12-14 Ort: UP NP, 8.0.59 SWS: 4 Studiengang: BA, MA Module (BA): 11 Module (MA): 7 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Teilnehmerbegrenzung: 5 Beschreibung: Eine LAN-Party ist ein Treffen, bei dem mehrere Personen mit ihren eigenen Computern oder Konsolen an einem Ort zusammenkommen, um gemeinsam im lokalen Netzwerk (Local Area Network, LAN) zu spielen. Im Mittelpunkt stehen Multiplayer-Spiele, die entweder im Wettbewerb gegeneinander oder im Team miteinander bestritten werden. Neben dem Spielen selbst prägen auch das gemeinschaftliche Erleben, Feiern und der Austausch unter Gleichgesinnten solche Veranstaltungen.
Das Projekt „LAN-Party“ widmet sich der Untersuchung dieses Konzepts des gemeinsamen Spielens. Studierende sollen dabei sowohl theoretische Grundlagen reflektieren als auch praktische Erfahrungen sammeln. Im Verlauf des Semesters entwickeln sie ein Veranstaltungskonzept, das am Ende des Semesters (bzw. zu Beginn des Sommersemesters) umgesetzt wird.
Das Seminar entsteht in Kooperation mit dem Computerspielmuseum Berlin. Zusätzliche Informationen: Erster Termin am 20.10., weitere Termine nach Abspache |
| |
| |
|
Freie Projektarbeit (betreut)Dozenten: Prof. Dr. Heiko Christians, Prof. Dr. Jan Distelmeyer, Prof. Dr. Kathrin Friedrich, Prof. Winfried Gerling, Prof. Dr. Nico Heise, Dr. Kai Knörr, Dr. Susanne Müller, M.A. Judith Pietreck, Prof. Anne Quirynen, M.A. Alexander Schindler, Prof. Dr. Birgit Schneider, Torsten Schöbel, Dr. Katrin von Kap-herr, M.A. Anna Zaglyadnova Termin: nach Absprache Ort: nach Absprache SWS: 4 Studiengang: BA Module (BA): 11 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Freie Projektarbeit (betreut) Leistungspunkte: 10 Teilnehmerbegrenzung: 5 Beschreibung: Ziel ist die Entwicklung erster kleinerer freier Forschungsvorhaben oder eigenständiger Projektentwicklung bzw. auch von Kooperationen mit anderen Institutionen und Antragstellungen aus studentischer Initiative mit Recherche und theoretisch-praktischer Begleitung durch einen Lehrenden. Zusätzliche Informationen: Bitte setzen Sie sich rechzeitig mit einem der Lehrenden in Verbindung |
| |
| |
|
EMW Filmfestival (Arbeitstitel)Dozent: Prof. Anne Quirynen Termin: Arbeitstreffen nach Absprache Ort: N.N. SWS: 4 Studiengang: BA, MA Module (BA): 11 Module (MA): 7 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Forshung Leistungspunkte: 12 Zielgruppe: BA, MA Teilnehmerbegrenzung: 5 Beschreibung: Das Projekt richtet sich an alle, die Lust haben, Filme nicht nur anzuschauen, sondern aktiv zu vermitteln, zu organisieren und ausgewählte Arbeiten in einem kuratierten Rahmen öffentlich zu präsentieren und dabei sowohl die Vielfalt kreativer Zugänge als auch spezifische thematische Schwerpunkte sichtbar zu machen.
Seit über zwei Jahrzehnten haben Studierende der Europäischen Medienwissenschaft eine beeindruckende Vielfalt an filmischen Projekten hervorgebracht – mit unterschiedlichen Ansätzen, Strategien und Techniken
Wir sichten und analysieren Filme, diskutieren kuratorische Leitlinien und legen die Struktur unseres Formats fest – sei es als Reihe, einmaliges Event oder experimentelles Festival, Wir suchen geeignete Orte, entwickeln Konzepte für Sponsoring und Öffentlichkeitsarbeit und laden Alumni ein.
Zusätzliche Informationen: Im Sommersemester laden wir ein Publikum ein und machen die Arbeiten der Studierenden in einem öffentlichen Rahmen erlebbar. |
| |
| |
|
Modul 13: Kolloquium |
| |
| |
|
BA – PrüfungskolloquiumDozent: Prof. Dr. Jan Distelmeyer Termin: Mi, 10-12 Uhr Ort: FHP D 116 SWS: 2 Studiengang: BA Module (BA): 13 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Kolloquium Leistungspunkte: 6 Zielgruppe: BA Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Dieses Seminar ist als Diskussionsforum und Abschlusshilfe für alle gedacht, die an ihrer BA-Arbeit arbeiten.
Wir vermitteln umfassend alles, was es beim Schreiben der Arbeit, bei der Planung und Durchführung des Projektes und für die Disputation zu wissen gibt. Wir haben Zeit, um auf Ihre eigenen Belange einzugehen, also Textproben zu diskutieren, Themen zu vertiefen, die beim Verfassen/Erstellen und Erarbeiten der BA-Arbeit entstehen. Dabei kann es etwa um Zitierweisen, das Schreiben allgemein, die Eingrenzung des Themas, die Planung oder das Verfassen des Abstracts und formale Fragen gehen sowie die Besonderheiten der Projektarbeit. Das Seminar ist ein hilfreicher Begleiter für diese Phase. Wir legen auch großen Wert auch das Co-Teaching, indem wir Ihnen immer wieder Zeit geben, damit sie sich mit ihren KommilitonInnen austauschen und sich gegenseitig begleiten können.
Bis zur ersten Sitzung laden bitte alle TeilnehmerInnen ein PDF des Exposés ihrer BA-Arbeit in der Virtuellen Lehre hoch. Alle bereiten sich bitte zudem darauf vor, in der ersten Sitzung ihre BA-Arbeit kurz (5 Minuten) vorzustellen.
Zusätzliche Informationen: Das Seminar ist obligatorisch für alle, die im WiSe 2025/26 ihre BA-Arbeit anfertigen. |
| |
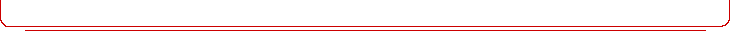 |







