|
|
|
| |
| |
|
Modul 2: Konfigurationen des Analogen und Digitalen |
| |
| |
|
Kritische Kartographie als mediale Praxis Dozent: M.A. Lydia Kray Termin: Di 16-20 Uhr (Seminar findet 14-tägig statt!) Ort: 1.19.1.19 SWS: 2 Studiengang: MA Module (MA): 2 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: MA Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Wie können wir den Raum, in dem wir leben, als ein Medium begreifen, dessen Form und Repräsentation die Art unseres Zusammenlebens prägt? Die physische Form unserer Umwelt limitiert die Art, wie wir in ihr leben: Umso definierter ein Raum, desto leichter vorhersehbar (und kontrollierbar) sind die Aktionen, die in ihm stattfinden können. Karten sind lange als Repräsentationen von Realität behandelt worden. Sie waren Mittel der Abbildung einer vermeintlich natürlichen Odnung. In diesem Seminar beschäftigen wir uns auf der Grundlage medienwissenschafticher Zugänge mit den ästhetischen, politischen und sozialen Räumen, die durch Kartierungen entstehen und mit medialen verfertigungen, die selbst einen kritischen kartographischen Blick eröffnen.
Im Zentrum steht die Entwicklung einer kritischen Perspektive auf Karten als Mittel der Stabilisierung und Legitimierung von Machträumen hin zu einer partizipativen Kartographie als medialer und aktivistischer Praxis.
Anhand von theoretischen Texten, die der Analyse dienen, wendet sich das Seminar (künstlerischen) Praxisbeispielen in Form von Filmen, Spielen (analog und digital) und aktivistischen Formen des Counter-mappings zu, die Kartographie für einen kritischen Blick öffnen, der die sozialen Relationen, Diskurse und politischen Landschaften sichtbar macht, die ihnen zugrunde liegen. Zur Diskussion stehen unterschiedliche Formate der Kartierung, seien sie filmisch, via Audioguide, textuell oder auch digital und interaktiv.
Dabei werden wir im Seminar theoretische Verständnisse von Räumlichkeit und Kartographierung erarbeiten, die eine postkoloniale Perspektive auf Eruopa und europäische Blickwinkel auf "Welt" kritisch verstehen lernen.
Darüber hinaus soll das Seminar dabei unterstützen, einen experimentellen Ansatz im Umgang mit Räumlichkeit und deren kartographischer Repräsentation zu entwickeln.
Literatur und Material (Auswahl):
This Is Not an Atlas
A Global Collection of Counter-Cartographies, kollektiv orangotango+ (Hrsg.), 2019.
In a Queer Time and Place
Transgender Bodies, Subcultural Lives, J. Jack Halberstam, 2005.
Tausend Plateaus
Kapitalismus und Schizophrenie, Gilles Deleuze und Fèlix Guattari, Berlin 1992.
Form, Substanz und Differenz
Gregory Bateson: Ökologie des Geistes. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1999
Potsdam Postkolonial
Tour durch den Park Sansoucci und Lektüre „Koloniale Geschichten des botanischen Gartens in Potsdam“
Soy y Estoy – ein politisches Rollenspiel mit situiertem Blick
(Felipe Román Osorio, Chile, 2016, deutsche Übersetzung 2018)
Zusätzliche Informationen: Testat: Vorstellung eines Gegenstands aus dem Seminar (Theroet. Text / Anwendungsbeispiel) anhand einer Fragestellung und anschließender Leitung einer Gruppendiskussion.
Das Seminar wird größtenteils asynchron stattfinden (Inputs der Dozierenden, die online abgerufen werden können, Rückmeldung und Arbeit an den Texten /Beispielen auf Onlineplattformen / Pads.)
|
| |
| |
|
Critical Zones - Horizonte einer neuen Erdpolitik. Seminar zur Ausstellung am ZKM KarlsruheDozenten: M.A. Alexander Schindler, Prof. Dr. Birgit Schneider Termin: mittwochs, 10-12 Uhr Ort: NP / online SWS: 2 Studiengang: MA Module (MA): 2 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Seminar mit Exkursionsanteil Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: BA und MA Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Im Mai sollte die gemeinschaftlich mit dem Anthropologen Bruno Latour kuratierte Ausstellung "Critical Zones" in Karlsruhe am Zentrum für Kunst und Medien physisch eröffnen. Dies ist nun auf unbekannt verschoben, doch die vielfältigen Krisen von Klimawandel und Anthropozän bleiben auch in Pandemiezeiten mehr als virulent. Die Kurator*innen der Ausstellung schreiben zu ihrer Ausstellung: "Lange blieben die Reaktionen der Erde auf unser menschliches Handeln unbeachtet, doch spätestens mit der Protestbewegung Fridays for Future ist die Klimakrise in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Die Gedankenausstellung »CRITICAL ZONES« lädt dazu ein, sich mit der KRITISCHEN Lage der Erde auf vielfältige Art und Weise zu befassen und neue Modi des Zusammenlebens zwischen allen Lebensformen zu erkunden."
Das Seminar nimmt die Ausstellung als Ausgangspunkt zur Diskussion dieser Fragen mit einem Schwerpunkt auf Gaiatheorie, den Wendungen, die Bruno Latours Forschungen hier vornehmen, sowie weiteren Lektüren in diesem Bereich. Wir werden uns aber auch wissenschaftlich-künstlerische Arbeiten anschauen, die unsere Vorstellungen von dem, was von diesen Krisen wie wahrnehmbar ist, ausweiten. Da die Exkursion nach Karlsruhe im Sommersemester nicht stattfinden kann, werden wir thematisieren, wie wir uns mit den Themen der Ausstellung unter digitalen Bedingungen befassen können, also ohne vor Ort zu sein.
Die Online-Version dieses Seminars wird eine Mischung aus synchronen Einheiten, Kleingruppenarbeiten, Diskussionen und eigenständiger Lektüre / Exzerpten / Reading Responses / Glossareinträgen sein. Zeitgleich zum Seminar gibt es Partner-Seminare an der FH, der UdK und der Kunsthochschule Weißensee, die im Rahmen des KLIMASEMESTERS unterrichtet werden. Wir werden im Verlauf der Veranstaltung über Treffpunkte dieser Gruppen nachdenken.
Zusätzliche Informationen: Das Testat besteht in aktiver Teilnahme sowie in regelmäßigen, kurzen, schriftlichen Beiträgen zu Themen des Seminars. Dies werden vorraussichtlich Zusammenfassungen, kurze Essayformate, kleine Artikel oder Definitionen sein. Die Möglichkeit einer Online-Publikation von Ergebnissen ist denkbar. Das Seminar wird abwechselnd aus synchronen und asynchronen Einheiten bestehen.
Das Seminar wird aufgrund der Bedingungen während des "Flexi-Semesters" übergreifend für MA und BA angeboten.
WICHTIG TERMINE: Wegen der Zusammenlegung der Seminare werden alle Synchrontermine jeweils mittwochs von 10-12 Uhr stattfinden! Ein erstes Test-Treffen über die Plattform Zoom findet am 22.4. um 10 Uhr statt (ca. 45 min). |
| |
| |
|
Modul 3: Visualität, Narrativität und Performativität |
| |
| |
|
RealitätsschockDozent: Prof. Dr. Marie-Luise Angerer Termin: Montag, 08:00-10:00 Ort: ZeM SWS: 2 Studiengang: MA Module (MA): 3 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Realitätsschock hat Sascha Lobo sein aktuelles Buch betitelt, worin er „10 Lehren aus der Gegenwart“ zieht. Diese Lehren umfassen vom Klima über Migration, Künstliche Intelligenz und das Wiedererstarken rechter Ideologien auch die Gefahren der chinesischen Weltmaschine. Alles umfassende und miteinander aufs engste verzahnte Themen. Ich möchte diese 10 Lehren in den ersten Wochen des SoSe zusammenfassen, um aus diesen einen Begriff der Realität zu destillieren. Dieser soll im zweiten Teil des Semesters mit dem Begriff des Realen kontrastiert werden, wie er vor allem in der Psychoanalyse und in den Arbeiten des slowenischen Philosophen Slavoj Zizek eingeführt und verwendet wird. Das psychische System des Menschen schützt sich – im Normalfall – vor dem Einbruch dieses Realen durch einen phantasmatischen Reizschutz. Reißt dieser – wie in Zeiten traumatischer Ereignisse – zeigt sich das Reale als Angriff auf jede Realität. Zusätzliche Informationen: Testat: Exposé für Hausarbeit oder Essay
Da die Seminare im SoSe am 20.04.2020 online beginnen, möchte ich alle bitten, sich in der virtuellen Lehr anzumelden, damit ich die online-Orga des Seminars dann konkretisieren kann. Montagvormittag bleibt, Uhrzeit wird noch fixiert, Rhythmus des Seminars ebenfalls. |
| |
| |
|
Flanieren. Nature Writing in Games und in der WirklichkeitDozenten: Dr. Sebastian Möring, Prof. Dr. Birgit Schneider Termin: montags, 12-14 Uhr und dienstags 14-16 Uhr Ort: 1.22.0.38 / online SWS: 2 Studiengang: MA Module (MA): 3 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: MA Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Henry D. Thoreau gilt als Begründer des Nature Writing, so der englische Begriff für eine vielfältige Literaturgattung, die gerade im Zeitalter des Anthropozäns eine Renaissance erfährt. Beim Nature Writing geht es darum, in einem Journal festzuhalten, was der direkten Beobachtung und Wahrnehmung erwächst, indem man dem Achtung schenkt, was gerade um einen herum zu sehen, spüren, hören oder riechen ist, indem alles in Aufmerksamkeit gebracht wird, ohne vorher festzulegen, worauf die Wahrnehmung gerichtet wird. Es geht bei dieser Form des Schreibens aber weniger darum eine „reine Natur“ zu finden, sondern genauso den Müll, die Straße, die Stadt oder die Monokulturfelder wahrzunehmen, die mit zum Bild gehören. Aber auch ästhetische Effekte wie Lichter, Farben oder Gerüche können registriert werden. Die Aufmerksamkeit richtet sich so auf die Wechselspiele und Verbindungen, mit denen die Dinge und Menschen um einen herum und mit einem selbst verwickelt und verwoben sind. Und schließlich dienen diese Momente als Anlass für daran anknüpfende Gefühle, Gedanken, Bedenken und Hoffnungen, die die Welt in ihrer Verbindung zu Menschen betrachten. Was ins Zentrum rückt, ist die eigene Wahrnehmung, das Erleben vor Ort, der eigene Körper mit all seinen Sinnen als Sensor und Spürzentrum, wo Empfindungen und Gedanken zusammenlaufen, und das die Erlebnisse durchlässig und aufmerksam registriert und mit den eigenen Vorerfahrungen, (Vor)Wissen und Gedanken verbindet.
Die Wahrnehmungen beim Durchwandern und Flanieren in unserer Umgebung werden wir jedoch nicht allein auf die Wirklichkeit anwenden, sondern mit denen in Computerspielen vergleichen, indem wir auch hier die Techniken des Nature Writing anwenden, z.B. im Spiel "Walden", das die Natur des Walden Pond zu Henry Throeaus Zeiten nachahmt. Auf diese Weise können wir die besondere Bedeutung des Spaziergangs in Zeiten kollektiver Quarantäne ergründen, aber auch vergleichen mit dem nun allerorts geforderten Weg ins Digitale.
Medienästhetische Begriffe, die wir im Gepäck haben für die Analyse eines Computerspiels sind z.B. Mimesis (Nachahmung), Immersion (Eintauchen), Schein, Simulation, Virtualität und Immaterialität, aber auch Begriffe wie Aura, Stimmung und Atmosphäre und schließlich die Idee von Medien als Umwelten. Mit diesen Begriffen lassen sich die ästhetischen Effekte einer Nachahmung von Natur in einem Kunstprodukt wie einem Spiel fassen.
Das Seminar wird in wenigen synchronen Sitzungen die Idee des Seminars vorstellen und zur Diskussion stellen, mit welchem Blick wir uns den beiden Umwelten annähern (Phase 1). Dann gilt es selbst auf Streifzüge in der eigenen Umgebung in einem Spiel der Wahl zu gehen (Phase 2), jede Teilnehmer*in wird also mit dem Rechner und auch draußen diese Form des Spazierengehens nutzen. Und schließlich (Phase 3) teilen wir unsere Texte, geben konstruktives Feedback und versuchen diese stilistisch und inhaltlich weiter zu bringen.
Zusätzliche Informationen: Testat: Das Testat besteht in 2-3 kleinen Texten im Sinne des Nature Writings im Verlauf des Seminars sowie aktive Teilnahme an den Diskussionen und kleine Rechercheaufträge.
|
| |
| |
|
Modul 5: Nichtlineares Erzählen |
| |
| |
|
"Im Anfang war die Technik." Hundert Jahre RadiokunstDozent: Dr. Kai Knörr Termin: Do 12-16 (Rahmenzeit für synchrones Arbeiten) Ort: Online tba SWS: 4 Studiengang: MA Module (MA): 5 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Projektseminar Leistungspunkte: 12 Zielgruppe: MA-EMW Teilnehmerbegrenzung: 15 Beschreibung: Mit kommentierten Lektüren einschlägiger Theorie- und Geschichtstexte, eigenen Textrecherchen und ausführlichem Hören von Archivmaterial erschließen wir uns Zugänge zu 100 Jahren Radioästhetik. Wann begann die Ära elektroakustischer Experimente? Wie wurde im ersten Jahrzehnt um das Hörspiel als Kunstform und die Gestaltung der Stimme im Radio gestritten? Welchen Einfluss hat der 'Einbruch der Katastrophe' auf die Erzählweisen des Mediums? Wann und warum wird das 'europäische Radiofeature' erfunden? (Wie) Spricht das Radio eigentlich mit sich selbst? Und was bleibt von der Magie des Mikrofons, akustischer Räume, des Aufnehmens, Montierens, Sendens und Empfangens in digitalen Konfigurationen und Umgebungen? Antworten darauf werden wir auch im praktischen Teil des Seminars durch Experimentieren mit Footage- und eigenem Material sowie zuhause vorhandenen technischen Mitteln suchen. Zusätzliche Informationen: In der Einschreibewoche verständigen wir uns über Plattformen zum synchronen und asynchronen Arbeiten im Seminar. Während der Rahmenzeit Do 12-16 können Videokonferenzen, Einzel- und Gruppengespräche organisiert werden. Anforderungen zum Modulabschluss: 20-minütige Präsentation und Dokumentation eines medienreflexiven/künstlerischen Projekts. Zur Präsentation ist ein Thesenpapier zu erarbeiten.
Literatur (Auswahl):
Bettina Wodianka: Radio als Hör-Spiel-Raum, Bielefeld 2018
Antje Vowinckel: Collagen im Hörspiel, Würzburg 1995
Katja Rothe: Katastrophen hören, Berlin 2009
Solveig Ottmann: Im Anfang war das Experiment, Berlin 2013 |
| |
| |
|
Modul 6: Mediale Umgebungen |
| |
| |
|
Interfaces we live by. Zur Aktualität der Desktop-/Screen-FilmeDozenten: Prof. Dr. Jan Distelmeyer, Prof. Anne Quirynen Termin: Do. 16-19 Uhr Ort: Online SWS: 4 Studiengang: MA Module (MA): 6 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: P Leistungspunkte: 12 ECTS Teilnehmerbegrenzung: 15 Beschreibung: Neben und in Verbindung mit unmittelbaren (existentiellen und körperlichen) Konsequenzen der Corona-Krise betreffen die aktuellen Entwicklungen viele Kernfragen der Medienwissenschaft – Fragen des Vermittelns und des Umgangs mit sowie Einsatzes von Medien. Dazu gehört insbesondere (nicht nur aber auch in Studium und Lehre) jene Entwicklung, dass sich soziales Leben zu einem Leben vor und mit Monitoren entwickelt. Online-Aktivitäten besetzen weltweit die neuen Freiräume des sozialen Ausnahmezustands. Grenzüberschreitend prägen Plattformen und Computer-Interfaces zunehmend den Zugang zur Welt.
Diese sich aktuell sowohl extensivierende als auch intensivierende Beziehung zwischen Mensch, Computer und Realität ist das Thema von Desktop-/Screen-Filme, die sich seit Mitte der 2010er Jahren als eigene und betont internationale Filmbewegung etabliert haben: Alles, was in diesen Kurz- und abendfüllende Spielfilmen, Essays und Dokumentationen geschieht, spielt sich auf einem Computermonitor ab. Seit Mitte der 2010er Jahre verhandeln Desktop-/Screen-Filme die Welt in den Programm-Fenstern und mit den Interfaces, die zum Alltag des Umgangs mit Computern gehören.
Darum bietet sich in diesem Ausnahme-Semester an, die gegenwärtige Situation der Corona-Krise für eine medienwissenschaftliche Auseinandersetzung zu und in diesem internationalen Feld der Desktop-/Screen-Filme zu nutzen. Leben mit Interfaces wird damit zu einem Rahmen für Projekte, die eigene Themen, Fragestellungen und Umsetzungen für medienreflexive Projekte Arbeiten entwickeln.
Prüfungsleistung: 20-minütige Präsentation und Dokumentation eines medienreflexiven/künstlerischen Projekts im Rahmen des Projektseminars. Zur Präsentation ist ein Thesenpapier zu erarbeiten.
Zusätzliche Informationen: Wir werden mit der Incom-Plattform arbeiten:
https://fhp.incom.org/workspace/8925
Der Termin (Do, 16-19 Uhr) bezieht sich auf das grundsätzliche Angebot gemeinsamer Online-Meetings. Nähere Absprachen zur Form der Lehre, die Rücksicht auf die Ausnahmesituation dieses Semesters nehmen, sind möglich. |
| |
| |
|
Modul 7: Experimentelle Forschungsarbeit |
| |
| |
|
EMW Website (laufendes Projekt)Dozenten: Prof. Dr. Jan Distelmeyer, Prof. Dr. Birgit Schneider Termin: tba Ort: tba SWS: 2 Studiengang: MA Module (MA): 7 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Projekt Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: MA Teilnehmerbegrenzung: 5 Beschreibung: Erarbeitung von Konzepten und Texten für die Europäische Medienwissenschaft |
| |
| |
|
Experimentelle ForschungsarbeitDozenten: Prof. Dr. Marie-Luise Angerer, PD Dr. Bernd Bösel, Prof. Dr. Jan Distelmeyer, Noam Gramlich, Prof. Dr. Nico Heise, Dr. Kai Knörr, M.A. Lydia Kray, Dr. Sebastian Möring, Dr. Susanne Müller, M.A. Judith Pietreck, Prof. Anne Quirynen, Prof. Dr. Birgit Schneider, Torsten Schöbel M.A., Dr. Katrin von Kap-herr Termin: nach Vereinbarung Ort: tba SWS: 4 Studiengang: MA Module (MA): 7 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Experimentelle Forschungsarbeit Leistungspunkte: 12 Teilnehmerbegrenzung: 5 Beschreibung: Ziel des Moduls ist die Entwicklung experimenteller Forschungsarbeiten durch die Studierenden selbst. Unter experimenteller Forschung ist die Untersuchung von Fragestellungen mittels medialer Aufbereitung zu verstehen, wozu gleichermaßen Recherche, eigene Literaturzusammenstellung, Konzipierung, Wahl der Darstellungsmittel bzw. des medialen Formats und die Durchführung zählt. Zusätzliche Informationen: Bitte setzen Sie sich rechzeitig mit einem der Lehrenden in Verbindung. |
| |
| |
|
Modul 8: Interdisziplinäres Ergänzungsstudium |
| |
| |
|
Visualizing Cultural Collections 1Dozenten: Mark-Jan Bludau, Viktoria Brüggemann, Prof. Dr. Marian Dörk Termin: Do 9:00 - 12:00 Uhr Ort: online SWS: 4 Studiengang: BA, MA Module (BA): 10 Module (MA): 8 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Projektseminar Leistungspunkte: 4 Zielgruppe: BA/MA Ergänzungsstudium Teilnehmerbegrenzung: 15 Beschreibung: For cultural institutions, such as museums, libraries or archives, it has become an inevitable but also greatly beneficial task to present their collections on the Web. Digitization promises unprecedented levels of access to cultural artifacts and exciting opportunities for interface design and information visualization. Nevertheless, there is still a lack of innovative approaches that move away from grids and compressed images towards generous interfaces which make the artifacts and artworks available for free exploration. How can we design interfaces for cultural collections that aim at both researchers and a broad public? How can we find visual representations that convey the abundance of the collection, but also the individuality of the artifacts? How do we deal with questions of representation in light of postcolonialism and critical design?
In this project course we will approach these questions in interdisciplinary teams. Advanced students of interface design, cultural management, and media studies will work together to explore and critically examine visualizations of cultural collections. In collaboration with cultural institutions, students will form small project teams and carry out hands-on research, from analyzing opportunities and possibilities to offline and online prototyping. The aim is to create visualizations that open novel perspectives on and interesting insights into the collections. As part of this process, we consider the visualizations to be cultural artifacts themselves that need to be interpreted and questioned, too.
Participants should have a solid understanding and practical experience with either information visualization or cultural collections – and an interest in the respective other. In interdisciplinary groups, participants will develop research projects and pursue their own questions. The results of the course will be presented at the end to the partners and documented in the form of a paper and a demo on the web.
In addition to this course please also visit the course Visualizing Cultural Collections 2. Zusätzliche Informationen: Please note: The language of teaching for this course is English.
>>>>EINSCHREIBUNG NICHT ÜBER DIESE WEBSITE, SONDERN ÜBER INCOM: https://fhp.incom.org/workspace/8754
Testat: active participation and group work
Optional können hier 4 benotete Punkte zusätzlich generiert werden über Präsentation + Dokumentation
Bitte bis 22.4. bei Interesse eine Mail an Victoria Brüggemann schicken: viktoria.brueggemann@fh-potsdam.de |
| |
| |
|
Seeing Green. Visuelle Strategien in Umwelt- und KlimaschutzDozent: Dr. Julia Meer Termin: Do, 10:05 – 13:30 Ort: FHP, tba SWS: 4 Studiengang: BA, MA Module (BA): 10 Module (MA): 8 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Projektseminar Leistungspunkte: 4 Zielgruppe: BA/MA Ergänzungsstudium Teilnehmerbegrenzung: 15 Beschreibung: Die für klimasensibles Verhalten notwendigen Informationen sind vorhanden und werden (meistenteils) verständlich, eindringlich und handlungsbefähigend kommuniziert. Warum also verändern dennoch so wenige Menschen ihr Verhalten? Und welche Rolle spielt Design in diesem Nicht-Handeln?
Gemeinsam analysieren wir ikonische Zeichen und Bilder und befragen sie auf die hinter ihnen stehenden Strategien und Implikationen. Das Recycling-Logo etwa kann derart gelesen werden, dass das Ausmaß unseres Konsums nicht verändert werden muss – solange wir bloß recyceln. Wir sammeln historische und aktuelle Fotografien (z.B. The Blue Marble – unser Planet vom Weltraum aus gesehen), Gegenstände (etwa Ziegelsteine, Schlauchboote und Jutebeutel), Zeichen (u.a. das Atomkraft? Nein Danke!-Logo), Grafiken (Kreislaufdiagramm, Info- und Datenvisualisierungen) sowie Kampagnen. Diese werden jeweils befragt und differenziert analysiert: In welchem Kontext sind sie entstanden? Wie wurden sie medial verbreitet? Mit welcher Kommunikationsabsicht wurden sie gestaltet? Gibt es spezifische ›Protest-Ästhetiken‹? Wie und warum etwa rekurriert Extinction Rebellion auf religiöse Motive? Wie verändern sich die visuellen Strategien von Greenpeace oder der Partei Die Grünen?
Dazu nutzen wir unterschiedliche Methoden der Bildanalyse und entwickeln aus dem Material abgeleitete designkritische Zugänge, beispielsweise über die Visuellen Auslegeordnungen, Expert*innen-Interviews oder diskursanalytische Zugriffe. So erlangen wir differenzierte Erkenntnissen über Erfolge und Misserfolge unterschiedlicher – auch aktueller – Kommunikationsstrategien.
Diese Analysen werden:
1. verschriftlicht (wahlweise als journalistischer oder wissenschaftlicher Text) und
2. an die Teilnehmer*innen aus dem Kurs ›Good News‹ von Prof. Lisa Bucher kommuniziert, so dass diese – selbstbestimmt in mehr oder weniger enger Kollaboration mit Ihnen – pointierte Visualisierungen entwickeln können (Comicstrips, Infografiken …).
3. Für die Werkschau in eine kleine Ausstellung aufbereitet.
Kleinere Exkursionen und Gastvorträge sind in Planung.
Ziele des Seminars sind:
- Überblick der Geschichte des Umwelt- und Klimaschutzes (damit einhergehend eine Geschichte der Professionalisierung des Designberufs, sowie technik- und medienhistorische Entwicklungen)
- Entwicklung eines ›Methoden-Tool-Kits‹ für Designanalysen
- differenzierte Erkenntnisse über Erfolge und Misserfolge historischer und aktueller Strategien des Umwelt- und Klimaschutzes
- Ziel der Kollaboration mit Lisa Buchers Kurs ist, redaktionelle Vorgaben und den Austausch zwischen Schreibenden und Gestaltenden besser kennenzulernen. Die Kurse finden meistenteils getrennt, parallel zueinander statt, für einige Sitzungen kommen wir zusammen.
Sie werden im Laufe des Kurses kurze und mittellange Texte verfassen. Auf Wunsch erhalten Sie eine Einführung in wissenschaftliches Schreiben, in jedem Fall erproben wir das Schreiben als Instrument im Erkenntnis- und Designprozess.
Voraussetzung für den Kurs ist die Bereitschaft und Fähigkeit selbstständig zu Arbeiten. Wir werden in der ersten Sitzung gemeinsam relevante Ereignisse, Bewegungen und die dazugehörigen Bildwelten/Objekte zusammen tragen. Schon in der zweiten Sitzung werden Sie auswählen, welches ikonische Zeichen/Gegenstand/Bild/Grafik Sie analysieren möchten. Recherchieren Sie daher gerne vorab bzw. machen Sie sich Gedanken, wo Ihre Interessen liegen.
> Zusätzliche Informationen: # Klima-Semester – Utopien der Gegenwart
>>>EINSCHREIBUNG NICHT ÜBER DIESE WEBSITE, SONDERN ÜBER INCOM: https://fhp.incom.org/workspace/8761/about
Beginn berits am 2.4.20
Testat: Testat: aktive Teilnahme + Erstellung kurzer und mittellanger Texte
|
| |
| |
|
Quer geschaut. Überblick Designgeschichte und -theorieDozent: Dr. Julia Meer Termin: Fr, 10:05 - 13:00 Ort: FHP, tba SWS: 4 Studiengang: BA, MA Module (BA): 10 Module (MA): 8 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Projektseminar Leistungspunkte: 4 Zielgruppe: BA/MA Ergänzungsstudium Teilnehmerbegrenzung: 15 Beschreibung: In diesem gleichwertig aus Inputs und Übungen bestehenden Vorlesungs-Seminar werden Sie mit vielfältigen Antworten auf die Frage: Was ist ›gutes‹ Design? konfrontiert. Ich stelle Ihnen zu den unten aufgeführten 11 Thesen je unterschiedliche historische und aktuelle Positionen vor, die wir gemeinsam in Übungen und Aufgaben diskutieren und prüfen.
Die Thesen lauten:
1. Gutes Design ist funktional.
2. Gutes Design ist demokratisch.
3. Gutes Design informiert.
4. Gutes Design ist innovativ.
5. Gutes Design ist schön.
6. Gutes Design ist nachhaltig.
7. Gutes Design ist identitätsstiftend.
8. Gutes Design ist lukrativ.
9. Gutes Design ist widerständig.
10. Gutes Design ist intersektional.
11. Gutes Design ist lernbar.
Das Seminar ist nicht chronologisch sondern themenzentriert aufgebaut. In der Sitzung zur These ›Gutes Design ist funktional‹ etwa werden unterschiedliche Auslegungen des Begriffs ›funktional‹ diskutiert und durch konkrete Beispiele anschaulich gemacht. Auf diese Weise erhalten Sie einen Überblick relevanter Fragestellungen, Diskurse und Positionen und schärfen Ihre Haltung als Gestalter*in.
Das Seminar richtet sich BA-Designstudent*innen des ersten Studienabschnitts (PD, KD, ID) und steht Student*innen der Europäischen Medienwissenschaften und Kulturarbeit offen.
> Zusätzliche Informationen: >>>EINSCHREIBUNG NICHT ÜBER DIESE WEBSITE, SONDERN ÜBER INCOM: https://fhp.incom.org/workspace/8766/about
Beginn berits am 3.4.20
Testat: aktive Teilnahme + Bearbeitung von Auufgaben
|
| |
| |
|
Visualizing Cultural Collections 2Dozenten: Mark-Jan Bludau, Viktoria Brüggemann, Prof. Dr. Marian Dörk Termin: Do 12-13:30 Ort: online SWS: 2 Studiengang: BA, MA Module (BA): 10 Module (MA): 8 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: BA/MA Ergänzungsstudium Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: For cultural institutions, such as museums, libraries or archives, it has become an inevitable but also greatly beneficial task to present their collections on the Web. Digitization promises unprecedented levels of access to cultural artifacts and exciting opportunities for interface design and information visualization. Nevertheless, there is still a lack of innovative approaches that move away from grids and compressed images towards generous interfaces which make the artifacts and artworks available for free exploration. How can we design interfaces for cultural collections that aim at both researchers and a broad public? How can we find visual representations that convey the abundance of the collection, but also the individuality of the artifacts? How do we deal with questions of representation in light of postcolonialism and critical design?
In addition to this course please also visit the project course Visualizing Cultural Collections 1 Zusätzliche Informationen: Part 2
Please note: The language of teaching for this course is English.
Testat: active participation |
| |
| |
|
Bröllin 2025 - Infos für alle Teilnehmer*innenDozenten: Dr. Susanne Müller, Prof. Dr. Birgit Schneider, Torsten Schöbel M.A., M.A. Anna Zaglyadnova Termin: Juni 25 Ort: Bröllin SWS: 2 Studiengang: BA, MA Module (BA): 10 Module (MA): 8 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Teilnehmerbegrenzung: 25 |
| |
| |
|
Modul 9: Kolloquium |
| |
| |
|
LaboratoriumDozenten: Prof. Dr. Marie-Luise Angerer, Prof. Anne Quirynen Termin: Mittwoch, 10:00-14:00 Ort: FH SWS: 4 Studiengang: MA Module (MA): 9 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 6 Zielgruppe: MA-Studierende Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Beim LABORATORIUM handelt es sich um eine experimentelle Form des Kolloqiums.
Die Besonderheit des LABORATORIUMS besteht darin, dass Masterstudierende aller Semester gemeinsam daran teilnehmen können.
Es soll ein Ort des Experimentierens sein.
So hat jede/r Studierende bereits während des Studiums die Möglichkeit, Themen, die ihn/sie abseits der angebotenen Lehrveranstaltungen interessieren in diese alternative Form des Kolloquiums einzubringen und mit den anderen zu diskutieren.
Das Kolloquium LABORATORIUM unterstützt die Studierenden insbesondere bei der Themenfindung, der Operationalisierung von Forschungsproblemen, Literaturrecherchen und Strukturierung von Arbeiten.
Wir möchten alle bitten, sich in der virtuellen Lehr anzumelden, damit wir die online-Orga des Laboratorium dann konkretisieren können. Mittwochvormittag bleibt, Uhrzeit wird noch fixiert, Rhythmus des Laboratorium ebenfalls. Zusätzliche Informationen: Wir werden mit der Income-Plattform arbeiten:
https://fhp.incom.org/workspace/8919
Aufgrund der aktuellen Situation werden wir das Lab jetzt für online-teaching auf 2 Stunden beschränken. Alles weitere werden wir it Ihnen besprechen, sobald Sie sich angemeldet haben. |
| |
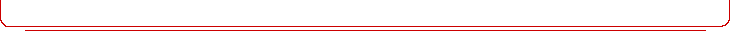 |







