|
|
|
| |
| |
|
Modul 1: Medium und Medialität |
| |
| |
|
Experimentelle Medienwissenschaft: Perspektiven auf Medium und Medialität (Konzepte der Potsdamer Medienwissenschaft)Dozenten: Prof. Dr. Heiko Christians, Prof. Dr. Jan Distelmeyer, Prof. Dr. Kathrin Friedrich, Prof. Winfried Gerling, Prof. Dr. Birgit Schneider Termin: Fr., 12:00-13:30 (s.t.) Ort: FHP D 011 SWS: 3 Studiengang: MA Module (MA): 1 Pflichtveranstaltung: ja Veranstaltungsart: Vorlesung Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: obligatorisch für MA 1. Semester Teilnehmerbegrenzung: 50 Beschreibung: Die Vorlesung widmet sich zentralen Begriffen und Konzepten der Medienwissenschaft, die von Professor*innen der EMW vertreten werden. Anhand von Projekten und aktuellen Forschungsfragen bietet diese Vorlesung eine Einführung sowohl in grundsätzliche Fragen des Fachs als auch in die spezifischen Ansätze der Potsdamer Medienwissenschaft.
Die Vorlesung sieht für jede Sitzung Raum für Diskussionen vor.
Zusätzliche Informationen: Pflichtveranstaltung für 1. Semester MA EMW
|
| |
| |
|
Texte zur MedientheorieDozent: Prof. Dr. Jan Distelmeyer Termin: Do, 14-16 Uhr Ort: FHP D 116 SWS: 2 Studiengang: MA Module (MA): 1 Pflichtveranstaltung: ja Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: obligatorisch für MA 1. Semester Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Dieses Seminar wird einflussreiche Positionen des 20. und 21. Jahrhunderts diskutieren, die zur Genese medientheoretischer Fragestellungen beigetragen haben. Die Heterogenität der Perspektiven und Argumentationen und der damit verbundenen Medienverständnisse geben dabei zugleich einen Einblick in historische Veränderungen und diverse Praktiken der Theorie.
Zusätzliche Informationen: Pflichtveranstaltung für 1. Semester MA EMW
Testat: Skizze "Was (bitte) soll Medientheorie?" (Umfang ca. 2 Seiten) |
| |
| |
|
Modul 2: Konfigurationen des Analogen und Digitalen |
| |
| |
|
Künstliche Intelligenz & Nachhaltigkeit. Konzepte, Praktiken und MaterialitätenDozent: Dr. Theresa Züger Termin: Mi, 14-18 Uhr (14-tägig) Ort: FHP D 119 SWS: 2 Studiengang: MA Module (MA): 2 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: MA Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Seminar von Theresa Züger
Das Zusammenspiel zwischen Nachhaltigkeit und Technologien, die als “Künstliche Intelligenz” bezeichnet werden, ist besonders vor dem Hintergrund der Klimakrise in zwei gegenläufigen Richtungen relevant: Zum einen wird KI als Werkzeug gegen die Auswirkungen des Klimawandels gesehen und von manchen gar als eine zentrale Lösung präsentiert. Zum anderen erfordern die Herstellung und der Betrieb von Rechenzentren als materielle Basis von Machine Learning als auch das Training von KI-Modellen einen relevanten und vor allem tendenziell steigenden Ressourcenaufwand. KI-Entwicklung braucht nicht nur Strom, sondern auch Rohstoffe wie seltene Erden und Wasser zur Kühlung von Rechenzentren.
Das Seminar nimmt beide Blickrichtungen auf und beleuchtet einerseits Beispiele des Einsatzes von KI zu Zwecken des Umweltschutzes oder der Klimaforschung. Andererseits werden wir versuchen, uns einem Verständnis des Ressourcenverbrauchs des KI-Sektors auf Basis derzeitiger Forschung anzunähern - “versuchen”, da der tatsächliche Energie- und Ressourcenverbrauch oft nicht ausreichend dokumentiert und veröffentlicht wird. Um der Komplexität der Verflechtung zwischen KI und Nachhaltigkeit und ihrer Praxis gerecht zu werden, werden wir nicht nur Praktiker*innen und Expert*innen in das Seminar einbinden, sondern (wenn realisierbar) auch ein lokales Rechenzentrum besuchen.
Auftakt des Seminars ist ein interdisziplinärer Workshop mit internationalen Gästen, der in Kooperation mit Jan Distelmeyer und dem Alexander von Humboldt Institute für Internet und Gesellschaft veranstaltet wird.
Zusätzliche Informationen: Testat: 10 Minuten Vortrag mit Präsentation als Zusammenfassung für die Mitstudierenden über je eine Studie zum Thema KI und Ressourcenverbrauch (Zuteilung erfolgt im Seminar).
|
| |
| |
|
Ostdeutsches VisualisierenDozent: Dr. Paul Heinicker Termin: Freitag 10:00 - 11:30 Ort: FHP D 103 SWS: 2 Studiengang: MA Module (MA): 2 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Seminar Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Wie und von wem wird eine ostdeutsche Gesellschaft seit 1990 sichtbar gemacht? Mediale Darstellungen – oftmals aus westdeutscher Perspektive – reduzieren Ostdeutschland nicht selten auf vereinfachte, defizitorientierte Narrative: Dialekt, rechte Wut oder schlicht der „blaue Osten“. Diese Bilder sind nicht neutral, sondern prägen maßgeblich den öffentlichen Diskurs über die Region.
Das Seminar untersucht zunächst diese Fremdbilder, die in Zeitungen, Datenvisualisierungen, Infografiken oder Social-Media-Beiträgen zirkulieren. Im Fokus steht, wie Visualisierungen Komplexität verflachen, Narrative reproduzieren und gesellschaftliche Wahrnehmung strukturieren. Hierfür arbeiten wir qualitativ mit Methoden der Bildanalyse, erweitern unseren Korpus aber auch quantitativ, etwa durch Web-Scraping.
Im zweiten Schritt richtet das Seminar den Blick auf ostdeutsche Eigenbilder. Basierend auf dem Konzept des Transformationswissens explorieren wir Selbstbilder, die in Kunst, Gestaltung und gesellschaftlichen Praktiken artikuliert werden. Durch Ausstellungsbesuche (z. B. Das Minsk in Potsdam) und die Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Positionen analysieren wir, wie Differenz, Komplexität und Ambivalenz in diesen Eigenbildern sichtbar werden.
Neben der theoretischen Rahmung eröffnet das Seminar auch einen praktischen Zugang: Gemeinsam entwickeln wir diagrammatische Interventionen, die zwischen Fremd- und Eigenbildern vermitteln und alternative Sichtbarkeiten ostdeutscher Gesellschaften erproben.
Das Seminar richtet sich ausdrücklich an Studierende mit allen Sozialisierungshintergründen. Es geht nicht darum, „den Osten“ nur aus einer innereigenen Perspektive zu betrachten, sondern vielmehr darum, durch den Austausch unterschiedlicher Sichtweisen neue Formen der Auseinandersetzung und Gestaltung zu entwickeln.
Testat: Erstellung eines "ostdeutschen" Diagramms und eine schriftliche Kurzreflexion (2 Seiten)
Zusätzliche Informationen: Literaturempfehlungen:
Engler, Wolfang. 2004. “Die Ostdeutschen als Avantgarde”. Berlin: Aufbau Verlag.
Mau, Steffen. 2024. “Ungleich vereint: Warum der Osten anders bleibt”. Berlin: Suhrkamp.
Simon, Anette, 2009. “Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin: Versuch über ostdeutsche Identitäten”. Gießen: Psychosozial-Verlag.
|
| |
| |
|
Modul 3: Visualität, Narrativität und Performativität |
| |
| |
|
Warum es die Technik nicht gibt: Eine Einführung in alternative Konzeptionen des Technischen Dozent: PD Dr. Bernd Bösel Termin: Blockseminar Februar Ort: Uni Potsdam SWS: 2 Studiengang: MA Module (MA): 3 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: alle MA-Studierenden Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Das Medium Sprache verleitet uns zu Abstraktionen, die oftmals zu groß und zu grob sind, um die Welt angemessen zu beschreiben. Wir verwenden alltäglich Begriffe, von denen wir oft nicht wissen, was sie genau sagen. Einer dieser Begriffe ist »Technik«, der im Deutschen gerne so verwendet wird, als bezeichnete er einen klar demarkierten Bereich der Welt. Aber »die« Technik oder einfach nur »Technik« gibt es gar nicht. Was uns tatsächlich begegnet, was uns durchdringt und beschäftigt, sind vielmehr Techniken und Technologien. Im Plural vom Technischen zu sprechen, ist weit mehr als eine bloß akademische Übung in Präzision; vielmehr öffnet die Pluralisierung den Diskurs für Differenzen und Alternativen. Erst dann wird es klar, dass die Art und Weise, wie das Technische vornehmlich diskursiviert, inszeniert und vermarktet wird, kein Schicksal darstellt, dem wir uns fügen müssen. Vielmehr gibt es immer zugleich widerstreitende Denkmodelle und Weisen, die Welt zu technisieren – und das inkludiert unsere Beziehungen zu Mitmenschen und anderen Mitwesen, sowie uns selbst, d.h. unsere Körper, unsere Seelen und unseren Geist.
Die »Frage nach der Technik« (Heidegger) ist zu übersetzen in die Frage nach den konkreten Techniken und Technologien; in die Frage, wie es dazu kommen konnte, dass wir glauben, dass es Sinn macht, von »der« Technik zu sprechen; in die Frage nach den Machtverhältnissen, die sich in einer solchen Singularisierung des Technischen zum Ausdruck bringt; in die Frage nach alternativen Konzepten des Technischen; in die Frage nach Techniken des Widerständigen, der Kritik, der Gegenhegemonie etc.
Wir werden im Seminar einigen dieser alternativen Weisen, über das Technische zu sprechen, nachgehen. Die Impulse sind vielfältig: Sie kommen aus dem Postkolonialismus, aus dem Feminismus, aus der Kulturtechnikforschung, aus der Medienarchäologie, aus der Kunstgeschichte und der ästhetischen Theorie, aus der Soziologie und natürlich auch aus der (Technik-)Philosophie. Die zu sichtende Literatur ist dementsprechend breit. Die Interessen der Teilnehmenden werden bei der Auswahl nach Möglichkeit berücksichtigt.
Testat: Präsentation (10 bis maximal 15 Minuten) über eine selbst gewählte alternative Technik-Konzeption. Zur Wahl stehen die Quellen, die im Seminar zur Verfügung gestellt werden, es können aber auch Ergebnisse eigenständiger Recherchen präsentiert werden. Ziel ist es, über die Präsentation in eine anregende gemeinsame Diskussion einzusteigen.
Das Seminar wird geblockt in der Woche vom 9.–13. Februar 2026 in Präsenz an der Uni Potsdam stattfinden. Eine ausführliche, vierstündige Vorbesprechung findet im November nach Möglichkeit ebenfalls in Präsenz statt, der genaue Termin hierfür wird mit den angemeldeten Teilnehmer*innen noch vereinbart. Zusätzliche Informationen: Vorläufige Literaturliste:
Renata Avila Pinto: »Wider den digitalen Kolonialismus: Eine Zukunft ohne Big Tech liegt näher, als wir denken«, in: Digitaler Kolonialismus, Beck 2025, S. 302-312
Lori Emerson: Other Networks: A Radical Technology Sourcebook, Anthology Editions 2025
Yuk Hui: Die Frage nach der Technik in China. Ein Essay über die Kosmotechnik, Matthes & Seitz 2020
Amanda Boetzkes: The Ethics of Earth Art, University of Minnesota Press 2013
Isabelle Stengers: »Introductory Notes On an Ecology of Practice«, Cultural Studies Review vol. 11/1, 2005
Judy Wajcman: Technik und Geschlecht: Die feministische Technikdebatte, Campus 1994
Ivan Illich: Selbstbegrenzung. Eine politische Kritik der Technik, Beck 1975.
Martin Heidegger: »Die Frage nach der Technik« (1954), in: ders., Vorträge und Aufsätze, Klostermann 2000.
|
| |
| |
|
Performing XR – Handlungsmöglichkeiten und Realitätsmedien Dozent: Prof. Dr. Kathrin Friedrich Termin: Mo., 14:15-15:45 Ort: Neues Palais, 1.1.07 SWS: 2 Studiengang: MA Module (MA): 3 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Seminar Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Der Einsatz von Extended Reality (XR) Technologien verspricht neue Ausdrucks- und Handlungsmöglichkeiten – in Filmproduktionen, Medienkunst, Theater und aktivistischer Praxis. Im Seminar gehen wir medientheoretisch der Frage nach, welche Versprechen und Möglichkeiten in Bezug auf Inszenierungs-, Interaktions- und Erzählweisen sowie politischer und sozialer Teilhabe mit Realitätsmedien verbunden werden. Ein Fokus wird dabei die Frage sein, wie Körperlichkeit in XR-Umgebungen performativ hervorgebracht, transformiert und wahrgenommen wird.
Die Terminplanung, Arbeitsweise sowie Gestaltung des Referats wird zu Beginn des Seminars besprochen. Zusätzliche Informationen: Testat: Referat (10 Minuten) |
| |
| |
|
Modul 4: Mediale Gestaltung |
| |
| |
|
Mediale Gestaltung: Einführung | Walking/Mapping – Gehen als ästhetische PraxisDozent: Prof. Winfried Gerling Termin: Mi. 10:00 - 13:30 Ort: FHP D103 SWS: 8 Studiengang: MA Module (MA): 4 Pflichtveranstaltung: ja Veranstaltungsart: Projektseminar Leistungspunkte: 10 Zielgruppe: 1. Semester MA EMW Teilnehmerbegrenzung: 15 Beschreibung: Das Gehen ist eine der elementaren menschlichen Bewegungen – und zugleich ein kulturell, politisch und ästhetisch aufgeladenes Handeln.
In dieser Veranstaltung wird erkundet wie Gehen als Praxis Wahrnehmung, Raumaneignung und ästhetische/künstlerische Forschung sein kann.
Ausgehend von theoretischen Texten und Beispielen aus Kunst, Literatur und Medien wird untersucht wie Gehen selbst als ästhetische Praxis verstanden werden kann und welche Rolle Medien bei der Darstellung und Reflexion des Gehens spielen, von Tagebüchern und Karten zu GPS-Tracking und performativen Dokumentationen.
Wie wird das Gehen und damit der Raum zu Text, Bild, Ton, Video oder Karte?
Es sollen mediale Projekte konzipiert werden, die diese Prozesse kritisch reflektieren:
Wie sehen Konzepte und Methoden des Gehens und Kartierens in verschiedenen Bereichen, wie Kunst, Wissenschaft, Kultur und im Privaten aus?
Welche Motivationen und Strategien stehen hinter dem Gehen als bewusste Praxis?
--- Zusätzliche Informationen: Obligatorisches Seminar für das 1. Semester MA. Das Modul Mediale Gestaltung ist Grundlagenmodul und beinhaltet die Analyse und Konzeption von Projekten in vornehmlich digitalen Medien. Es werden sowohl Kenntnisse in medienübergreifenden Gestaltungszusammenhängen erschlossen als auch aktuelle Medientechnologien analysiert und genutzt.
Dieses Modul wird im Rahmen des Projektseminars mit einer 10-minütigen Präsentation und Dokumentation des medienreflexiven Projekts abgeschlossen.
Im Kurs werden mehrere Workshops angeboten (Präsentation, Sound, Video, 2d Gestaltung, Programmierung, Fotografie), die verpflichtend mit einer Übung abgeschlossen werden. |
| |
| |
|
Modul 5: Nichtlineares Erzählen |
| |
| |
|
Creating in Reverse: Mit "unsichtbaren" Elementen arbeiten.Dozent: Simon-Mary Vincent Termin: Do. 10:00 -13:30 Ort: FHP D103 SWS: 4 Studiengang: MA Module (MA): 5 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: P Leistungspunkte: 12 Zielgruppe: EMW Master Teilnehmerbegrenzung: 15 Beschreibung: Wie werden medienbasierte Werke „geschaffen“? Welche Werkzeuge, Begriffe und Methoden werden in solchen Werken verwendet und welche brauchen wir wiederum, um sie zu verstehen? Welche un/sichtbaren Narrative artikulieren sie und was können wir von ihnen über unsere eigene kreative Praxis lernen?
Ausgehend von der Idee des „vollendeten Werks“ werden in diesem Seminar verschiedene medienbasierte Ansätze erörtert, wobei rückwärts und in „entgegengesetzte“ Richtungen zu verschiedenen Narrativen gearbeitet wird, die sowohl dem kreativen Akt selbst innewohnen als auch von ihm artikuliert werden.
Zusätzlich und als Annäherung an das im Seminar besprochene Material werden wir im Laufe des Semesters kleine kreative Übungen durchführen.
Anhand dieses Grundrahmens werden Student:innen im Laufe des Semesters ihre eigenen Projekte erforschen und entwickeln, die dann zu Beginn des SS2026 bearbeitet und präsentiert werden. |
| |
| |
|
Modul 6: Mediale Umgebungen |
| |
| |
|
Widerständige Archive als PraxisDozent: Dr. Bettina Knaup Termin: Di. 14-17Uhr Ort: FHP D116 SWS: 4 Studiengang: MA Module (MA): 6 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: P Leistungspunkte: 12 Zielgruppe: MA Teilnehmerbegrenzung: 15 Beschreibung: In diesem Projektseminar werden künstlerische und aktivistische Archive untersucht, die sich explizit dem Vergessen, der Unterdrückung oder der Auslöschung widersetzen.
Widerständige Archive werden dabei als wesentliche Infrastruktur - als „bewohnbarer Grund“ (Judith Butler) - für kommende Generationen von Aktivist*innen, Künstler*innen, Kulturarbeiter*innen, Autor*innen und engagierten Bürger*innen verstanden. Wir werden Archivarische Infrastrukturen sowohl in ihrer materiellen und topographischen Dimension als auch als soziale Formationen betrachten, die auf kontinuierliche Pflege, Fürsorge und Weiterentwicklung angewiesen sind, und die sich erst durch ihre Nutzung wirklich entfalten.
Im Verlauf des Seminars werden wir neben der Lektüre theoretischer Texte ausgewählte Archive und Ausstellungen besuchen, künstlerische Archivprojekte analysieren und Gespräche mit Archivar*innen sowie Künstler*innen führen. Im Zentrum steht dabei die Entwicklung eines eigenen Projekts.
Den inhaltlichen Rahmen bildet das von mir mitentwickelte serielle Archivprojekt re.act.feminism (seit 2008), das 2026 im Kontext einer Ausstellung mit anderen Archiven präsentiert wird. |
| |
| |
|
Modul 7: Experimentelle Forschungsarbeit |
| |
| |
|
LAN-PartyDozent: M.A. Anna Zaglyadnova Termin: Mo, 12-14 Ort: UP NP, 8.0.59 SWS: 4 Studiengang: BA, MA Module (BA): 11 Module (MA): 7 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Teilnehmerbegrenzung: 5 Beschreibung: Eine LAN-Party ist ein Treffen, bei dem mehrere Personen mit ihren eigenen Computern oder Konsolen an einem Ort zusammenkommen, um gemeinsam im lokalen Netzwerk (Local Area Network, LAN) zu spielen. Im Mittelpunkt stehen Multiplayer-Spiele, die entweder im Wettbewerb gegeneinander oder im Team miteinander bestritten werden. Neben dem Spielen selbst prägen auch das gemeinschaftliche Erleben, Feiern und der Austausch unter Gleichgesinnten solche Veranstaltungen.
Das Projekt „LAN-Party“ widmet sich der Untersuchung dieses Konzepts des gemeinsamen Spielens. Studierende sollen dabei sowohl theoretische Grundlagen reflektieren als auch praktische Erfahrungen sammeln. Im Verlauf des Semesters entwickeln sie ein Veranstaltungskonzept, das am Ende des Semesters (bzw. zu Beginn des Sommersemesters) umgesetzt wird.
Das Seminar entsteht in Kooperation mit dem Computerspielmuseum Berlin. Zusätzliche Informationen: Erster Termin am 20.10., weitere Termine nach Abspache |
| |
| |
|
Experimentelle ForschungsarbeitDozenten: Prof. Dr. Heiko Christians, Prof. Dr. Jan Distelmeyer, Prof. Dr. Kathrin Friedrich, Prof. Winfried Gerling, Prof. Dr. Nico Heise, Dr. Kai Knörr, Dr. Susanne Müller, M.A. Judith Pietreck, Prof. Anne Quirynen, M.A. Alexander Schindler, Prof. Dr. Birgit Schneider, Torsten Schöbel, Dr. Katrin von Kap-herr, M.A. Anna Zaglyadnova Termin: nach Absprache Ort: nach Absprache SWS: 4 Studiengang: MA Module (MA): 7 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Experimentelle Forschungsarbeit Leistungspunkte: 12 Teilnehmerbegrenzung: 5 Beschreibung: Ziel des Moduls ist die Entwicklung experimenteller Forschungsarbeiten durch die Studierenden selbst. Unter experimenteller Forschung ist die Untersuchung von Fragestellungen mittels medialer Aufbereitung zu verstehen, wozu gleichermaßen Recherche, eigene Literaturzusammenstellung, Konzipierung, Wahl der Darstellungsmittel bzw. des medialen Formats und die Durchführung zählt.
Zusätzliche Informationen: Bitte setzen Sie sich rechzeitig mit einem der Lehrenden in Verbindung |
| |
| |
|
EMW Filmfestival (Arbeitstitel)Dozent: Prof. Anne Quirynen Termin: Arbeitstreffen nach Absprache Ort: N.N. SWS: 4 Studiengang: BA, MA Module (BA): 11 Module (MA): 7 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Forshung Leistungspunkte: 12 Zielgruppe: BA, MA Teilnehmerbegrenzung: 5 Beschreibung: Das Projekt richtet sich an alle, die Lust haben, Filme nicht nur anzuschauen, sondern aktiv zu vermitteln, zu organisieren und ausgewählte Arbeiten in einem kuratierten Rahmen öffentlich zu präsentieren und dabei sowohl die Vielfalt kreativer Zugänge als auch spezifische thematische Schwerpunkte sichtbar zu machen.
Seit über zwei Jahrzehnten haben Studierende der Europäischen Medienwissenschaft eine beeindruckende Vielfalt an filmischen Projekten hervorgebracht – mit unterschiedlichen Ansätzen, Strategien und Techniken
Wir sichten und analysieren Filme, diskutieren kuratorische Leitlinien und legen die Struktur unseres Formats fest – sei es als Reihe, einmaliges Event oder experimentelles Festival, Wir suchen geeignete Orte, entwickeln Konzepte für Sponsoring und Öffentlichkeitsarbeit und laden Alumni ein.
Zusätzliche Informationen: Im Sommersemester laden wir ein Publikum ein und machen die Arbeiten der Studierenden in einem öffentlichen Rahmen erlebbar. |
| |
| |
|
Modul 8: Interdisziplinäres Ergänzungsstudium |
| |
| |
|
Urheber-, Design- und Medienrecht im europäischen Kontext (Vorlesung mit integrierter Übung)Dozent: Prof. Dr. Nico Heise Termin: Dienstags, 10:00 bis 13:00 Uhr Ort: FH, D/011 SWS: 3 Studiengang: BA, MA Module (BA): 3 Module (MA): 8 Pflichtveranstaltung: ja Veranstaltungsart: Vorlesung Leistungspunkte: 3 Zielgruppe: empfohlen für BA 1. oder 2. Fachsemester Teilnehmerbegrenzung: 90 Beschreibung: Die Vorlesung behandelt die Grundzüge des Urheber-, Design-, Lizenz- und Äußerungsrechts im deutschen und im europäischen Kontext. Dazu gehören u.a. die Fragen, welche Werke urheberrechtlich geschützt sein können (z.B. Text, Fotografie, Film, bildende Kunst, Computerprogramme), wie ein Design eingetragen werden kann, wie lange der Schutz währt, wie Rechte lizensiert werden können und welche Möglichkeiten ein Rechteinhaber hat, gegen Rechtsverletzungen vorzugehen. Ein weiteres Thema der Vorlesung sind die Bedingungen und Limitierungen der (nicht nur journalistischen) Wort- und Bildberichterstattung. Besonders relevant sind dabei die unterschiedlichen Facetten des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Recht am eigenen Bild, Schutz der persönlichen Ehre) einschließlich des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung (Datenschutz). Neben den historischen und ökonomischen Hintergründen des Medienrechts werden wir insbesondere die großen Herausforderungen diskutieren, die sich aus der Entwicklung der digitalen Medien und des Internets für dieses Rechtsgebiet ergeben. Im Rahmen einer integrierten Übung werden wir das Gelernte anhand von praktischen Fällen trainieren. Zusätzliche Informationen: Abschluss: Klausur |
| |
| |
|
Medienrecht in Europa (Seminar)Dozent: Prof. Dr. Nico Heise Termin: Dienstags, 14:00-16:00 Ort: FH D/103 SWS: 2 Studiengang: BA, MA Module (BA): 3 Module (MA): 8 Pflichtveranstaltung: ja Veranstaltungsart: Seminar Leistungspunkte: 2 Zielgruppe: ab 3. Semester Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Medien sind ubiquitär verfügbar und hatten noch nie die Eigenschaft, sich an politische Ländergrenzen zu halten. Dennoch wurde die Regulierung von Medien - mit einigen Ausnahmen - über Jahrhunderte weitgehend von nationalen Gesetzgebern dominiert. Seit einigen Jahren hat sich das Bild jedenfalls in Europa erheblich verändert. Mit der Datenschutzgrundverordnung (2016), der Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt (2019), der Regulierung der großen online-Plattform durch den Digital Services Act (2022) oder dem Versuch, die Entwicklung von KI-Anwendungen durch den AI-Act (2024) zu steuern, hat die Europäische Union sehr ambitionierte medienrechtliche Regelungen auf den Weg gebracht. Und mit dem Europäischen Rechtsakt zur Medienfreiheit (ebenfalls aus dem Jahr 2024) sollen Journalist*innen und Medienanbieter vor politischer Einflussnahme geschützt und Bürgerinnen und Bürgern ein freier und pluralistischer Zugang zu Informationen gewährleistet werden. Im Seminar werden wir diese Gesetzgebungsmaßnahmen im Rahmen von Referaten und Diskussionen erörtern und sie dabei - auch im Vergleich zu außer-europäischen regulatorischen Ansätzen - kritisch hinterfragen. Zusätzliche Informationen: Das Seminar schließt an die Vorlesung zum Urheber-, Design- und Medienrecht an und setzt eine erfolgreiche Teilnahme an dieser Vorlesung in einem der vorhergehenden Semester voraus.
Testat: Referat (10 Minuten) |
| |
| |
|
Abstraction Today: The Real and the ImaginaryDozent: Dr. Svea Bräunert Termin: Di, 18:15 – 19:45 Ort: Online SWS: 2 Studiengang: MA Module (MA): 8 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Ring-VL Leistungspunkte: 2 Teilnehmerbegrenzung: 90 Beschreibung: From automated navigation to weather forecasts, data visualizations, and painting, abstraction has an undeniable presence in the contemporary world. Yet, it not only represents but also creates worlds. It is an operative concept that likewise possesses an imaginary thrust for perceiving things otherwise. As such, abstraction comes in many different forms: It is an aesthetic, a technology, an epistemology, and a practice. Therefore, it is also a political attitude, a mode of description, a tool of complexity reduction, and an instruction for intervention. Depending on its context and use, it can take on radically different connotations, ranging from dehumanizing to appealing, from affirmative to critical, from incorporated to autonomous.
Taking its cue from the different meanings and applications of abstraction, the international lecture series “Abstraction Today: The Real and the Imaginary” is designed as an interdisciplinary endeavor with a focus on visual media and digital culture. Most digital technologies (like networks, computer simulation or artificial intelligence) and correlated practices are closely connected to different forms of abstraction on different levels. To do justice to the complexity of the phenomenon, the series brings together a group of international scholars, artists, and curators who speak on abstraction today as it unfolds in fields such as art, photography, film, design, image science, visual culture studies, philosophy, and more. Grounding the inquiries into the contemporary conditions of abstraction are contributions focusing on its historical lineage, most importantly its emergence within the discourse of modernism to be understood in its global and postcolonial plurality.
With Presentations by Kim Albrecht, Crystal Campbell, Sabine Eckmann, Henning Engelke, David Getsy, Till Heilmann, Evan Hume, Razvan Ion, Sven Luetticken, Birgit Schneider, Alberto Toscano, Isabel Wünsche.
Zusätzliche Informationen: The international lecture series is co-organized by the Brandenburg Center for Media Studies and the University of Bonn (Media Studies & Art History). It takes place online.
You can find the full program here: https://www.medienwissenschaft.uni-bonn.de/lehrveranstaltungen/abstraction-today-1
EMW students can enroll in the lecture series as part of "Modul 08: Interdisziplinäres Ergänzungsstudium." They will be asked to write a three-page essay in response to one of the lectures. Also, there will be three check-in dates to talk about the presentations. These check-ins will take place online on October 21 (organizational questions), January 6, and February 3.
|
| |
| |
|
Black Box: Future Love Dozent: Prof. Myriel Milicevic Termin: Di 10-15:30 Ort: FH LW226 SWS: 6 Studiengang: BA, MA Module (BA): 10 Module (MA): 8 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Projektseminar Leistungspunkte: 4 Zielgruppe: Design, offen für EMW Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Liebe ist eine zentrale menschliche Erfahrung – und eine wirkmächtige: Viele wichtige Denker*innen haben Liebe als die transformative Kraft beschrieben, um gesellschaftliche Unterdrückungsstrukturen und andere Missstände zu beenden und positive Veränderungen in der Gesellschaft zu erreichen. Somit ist Liebe nicht nur eine Erfahrung, sondern vor allem eine Praktik (“love is a verb”), die mit Verantwortung einhergeht und damit auch gestaltbar ist. Die Liebe in ihrer großen Vielfalt ist im Wandel: z.B. prägen gesellschaftliche Phänomene wie Patriarchat, Globalisierung oder Kapitalismus, digitale Medien, globale Krisen und neue Familien- und Beziehungsmodelle, wie wir Menschen uns selbst wahrnehmen und wie wir zu anderen Menschen und nicht zuletzt auch zu nicht-menschlichen Lebewesen in Beziehung treten.
Wir bringen dieses Thema in die öffentliche Diskussion. Gemeinsam gestalten wir im Kurs eine mehrdimensionale öffentliche Intervention, die Menschen anregt darüber nachzudenken, welche Formen von Liebe sie selbst, und wir als Gesellschaft, in Zukunft wie leben könnten, wollen, oder nicht (mehr) wollen.
Dazu werden wir eine erfahrbare, sprichwörtlich begreifbare oder begehbare Intervention erschaffen, die Besucher*innen einlädt, spielerisch und reflektierend über dieses Thema nachzudenken. In Teamarbeit entwickeln wir „Black Boxes“ die metaphorisch für die Offenheit der Zukunft stehen und als interaktive Ausstellungsexponate – im besten Fall mobil und selbsterklärend/autark in der Nutzung – überraschen, erleuchten, informieren und zum Diskurs anregen.
Jede “Box” wird eine spezifische Form von Liebe repräsentieren - etwa Selbstliebe, Freund*innenschaft, Romantik, familiäre Liebe, Liebe zu Mitmenschen oder Liebe zur Natur. Körperlichkeit und Sexualität kann, muss aber nicht, dabei in all diesen Formen von Liebe als Querschnittsthema vorkommen. All diese Boxen werden über ihre individuellen Formate Menschen auf unterschiedliche Weise dazu anregen, neue eigene Visionen zur Liebe in der Zukunft auszuformulieren und sie kritisch zu reflektieren. Um dies zu erreichen, folgen wir dem vielfach erprobten Ansatz der „Xtopie“, die als Interventionskonzept inhaltlich auf die Ambivalenzen zwischen utopischen und dystopischen Zukunftsvorstellungen fokussiert und so Kontroversen und Dialog stimulieren kann (siehe xtopien.org).
Sie selbst werden das Tool sein oder beherbergen verschiedene interaktive Tools, Bildungsformate, Spiele oder andere Anregungen. Die Black Boxes variieren in Form, Größe, Haptik oder Materialität und stehen damit auch für die Vielfalt möglicher Zukünfte.
Wie sich die Boxen konkret entfalten, kann vieles sein. Sie können sowohl selbst den Interaktionsraum bilden oder dreidimensionale spekulative Objekte als Impulsgeber für Diskussionen über mögliche Zukünfte u.v.m. beinhalten. Denkbar sind auch beispielsweise digitale Tools wie QR Codes zu interaktiven Webseiten, Befragungstools, Perspektivwechsel-Spiele, Audiofiles, oder Anleitungen zu Selbstexperimenten.
Der Kurs umfasst ernsthaftes wie humorvolles, experimentelles wie kommunikatives, prozesshaftes wie ergebnisorientiertes Arbeiten. In verschiedenen Übungen werden wir unser Vorstellungsvermögen trainieren, Ideen iterieren, Themen eigenständig recherchieren, Bilder und Geschichten und partizipative Formate entwickeln, Modelle und Prototypen bauen, testen, realisieren und schließlich auch evaluieren.
Die Intervention erfolgt mit einem Praxispartner in Berlin.
Zusätzliche Informationen: !!!Anmeldung über Incom: https://fhp.incom.org/workspace/11384 |
| |
| |
|
Schlaf-Wandel Dozent: Prof. Myriel Milicevic Termin: Mo 10-15:30 Ort: FHP D105 SWS: 6 Studiengang: BA, MA Module (BA): 10 Module (MA): 8 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Projektseminar Leistungspunkte: 4 Zielgruppe: Design, offen für EMW Teilnehmerbegrenzung: keine Beschreibung: Gestaltung und Inszenierung von Schlaf-Mode, um auf Schlafen als un/gerechten Zustand aufmerksam zu machen.
Alles Leben kennt und braucht Ruhephasen – gerade auch in Großstädten wie Berlin. Was bedeutet „Schlafen“ im urbanen Raum für Menschen, Tiere, Pflanzen? Welche Auswirkungen haben zunehmende Hitze, helle Nächte, Luftverschmutzung oder unterschiedliche soziale Verhältnisse auf Schlaf, und damit auf das Wohlbefinden, die Gesundheit und die Lebensbedingungen aller Stadt-Lebewesen? Gibt es ein Umweltrecht auf Schlafen? Welche Umweltbedingungen ermöglichen oder verhindern erholsamen Schlaf in der Stadt? Und wie kann Gestaltung dazu beitragen, neue Sichtweisen auf dieses existenzielle Thema zu eröffnen?
In diesem Kurs setzen wir uns mit dem Recht auf Schlaf nicht nur aus der Sicht von Menschen, sondern auch aus einer More-than-Human-Perspektive auseinander. Nacht- und Tagschlafende, aber auch Winterschlafende und zwischendurch Ruhende leiden unter Umweltstress oder müssen sich anpassen: Verdunklung und Ohrstöpsel, nachts aufstehen und vor dem anschwellenden Verkehrslärm singen, oder Jagdzeiten verlegen sind nur einige Hilfsmaßnahmen. Die aus Stadtspaziergängen, Selbstexperimenten, Perspektivwechsel, wissenschaftlichen Recherchen und Inputs gewonnenen Erkenntnisse werden infografisch übersetzt, und Pyjamas, Nachthemden und sonstige Schlafwäsche als „Deklaration für Schlaf-Wandel“ gestaltet, um auf die Thematik aufmerksam zu machen. Die Schlaf-Wandel-Mode wird fotografisch im öffentlichen Raum inszeniert und dokumentiert und ggf. als Ausstellung präsentiert.
Die Wäsche wird mit einfachen Mitteln vor allem unter Aspekten von Reuse und Recycling von Materialien gefertigt. Vorkenntnisse im Nähen und Schneidern sind toll, aber keine Voraussetzung.
Der Kurs wird fachlich begleitet und findet in Kooperation mit Dr. Kim Mortega, Museum für Naturkunde Berlin und Herbert Lohner, BUND Berlin statt.
„Schlaf-Wandel“ knüpft an den Projektwochen-Kurs „Schlafen in der Stadt. Mapping eines un/gerechten Zustands“ an. Die Kurse können aber unabhängig voneinander belegt werden.
Zusätzliche Informationen: !!!! Achtung: Anmeldung über Incom
https://fhp.incom.org/workspace/11354 |
| |
| |
|
Modul 9: Kolloquium |
| |
| |
|
LaboratoriumDozent: Prof. Dr. Birgit Schneider Termin: montags, 10-12 Uhr Ort: Neues Palais, 9.2.04 SWS: 2 Studiengang: MA Module (MA): 9 Pflichtveranstaltung: - Veranstaltungsart: Laboratorium Teilnehmerbegrenzung: 25 Beschreibung: Beim LABORATORIUM handelt es sich um eine experimentelle Form des Kolloqiums.
Die Besonderheit des LABORATORIUMS besteht darin, dass Masterstudierende aller Semester gemeinsam daran teilnehmen können. Es soll ein Ort des Experimentierens sein. So hat jede/r Studierende bereits während des Studiums die Möglichkeit, Themen, die ihn/sie abseits der angebotenen Lehrveranstaltungen interessieren in diese alternative Form des Kolloquiums einzubringen und mit den anderen zu diskutieren. Das Kolloquium LABORATORIUM unterstützt die Studierenden insbesondere bei der Themenfindung, der Operationalisierung von Forschungsproblemen, Literaturrecherchen und Strukturierung von Arbeiten. |
| |
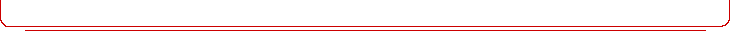 |







