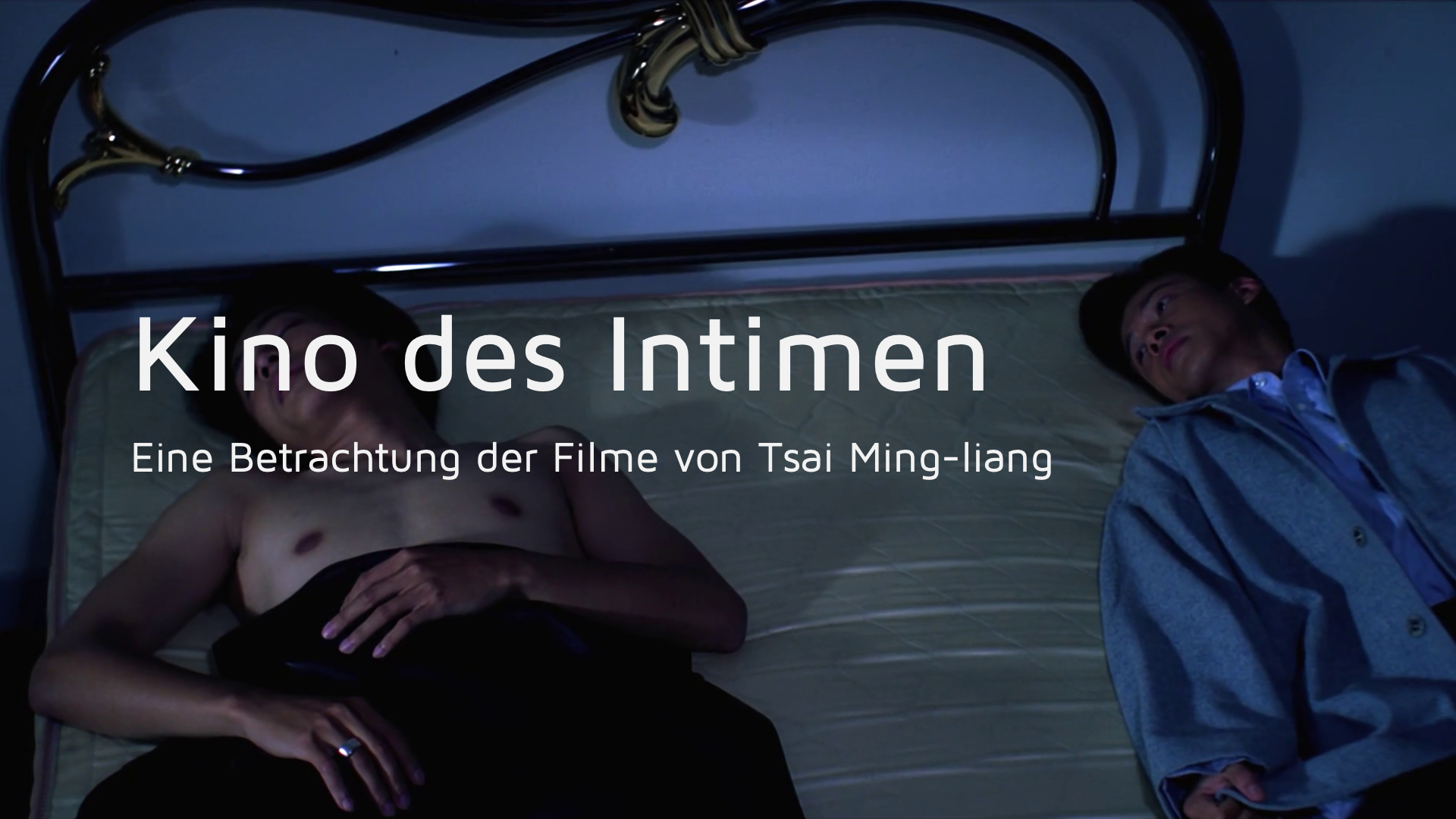| ||
| ||
 | ||
| ||
 | ||
| ||
 | ||
| ||
Natalie Popovic Garcia
Betreuung: Prof. Winfried Gerling / Prof. Dr. Birgit Schneider
El Camino de_ untersucht die Auswirkungen geschlechtsspezifischer Unsicherheiten von Frauen auf ihre Bewusstseinsprozesse und die damit verbundene Wegwahl im öffentlichen Raum von Mexiko-Stadt. Als Ergebnis ist ein Fotobuch entstanden, welches das Wirkungsgefüge aus Raum und Geschlecht analysiert. Es fasst die Wege drei verschiedener Frauen durch ihre Wohnbezirke als fotografische Sequenzen zusammen, die durch auf Interviews basierende Textelemente und Karten ergänzt werden. Diese mediale Kombination zeigt die zugrundeliegenden soziologischen Prozesse, die sich gegenseitig bedingen, wenn Frauen ihre Wege durch den öffentlichen Raum wählen: Das Fotobuch visualisiert so das Zusammenwirken geschlechtsspezifischer Unsicherheiten, die ein Produkt gesellschaftlicher Ordnungsmuster sind, mit menschlichem Bewusstsein und Fortbewegung. | ||
Tim Meldau
Betreuung: Prof. Dr. Jan Distelmeyer / Prof. Dr. Birgit Schneider
In der vorliegenden Arbeit werden Tsai Ming-liangs Filme aus einer Perspektive des Intimen betrachtet. Verstanden als ‚Verzugänglichung der eigenen Innerlichkeit‘ werden dazu in einem ersten Schritt die performativen und gesellschaftlichen Aspekte des Konzepts erkundet. Darauf aufbauend erfolgt eine filmanalytische Auseinandersetzung mit Tsais Spielfilmen. Anhand von DAYS wird untersucht, wie formale filmische Elemente intime Beziehungsgefüge abbilden und einen kontemplativen Raum schaffen, der dem Publikum eine reflexive Betrachtung des Gesehenen ermöglicht. Eine Auseinandersetzung mit der Figur des*der Herumtreiber*in in THE RIVER ermöglicht eine Ergründung der Probleme queerer Menschen, Intimität zu finden und ihre Sehnsucht nach menschlicher Verbindung zu erfüllen. Die Analyse von THE HOLE und GOODBYE, DRAGON INN zeigt anschließend, inwiefern Publikum-Film-Verhältnisse intime Züge tragen können und wie metafilmische und selbstreflexive Aspekte der Filme dazu beitragen. | ||
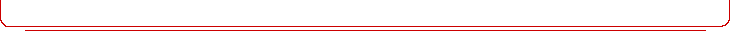 | ||