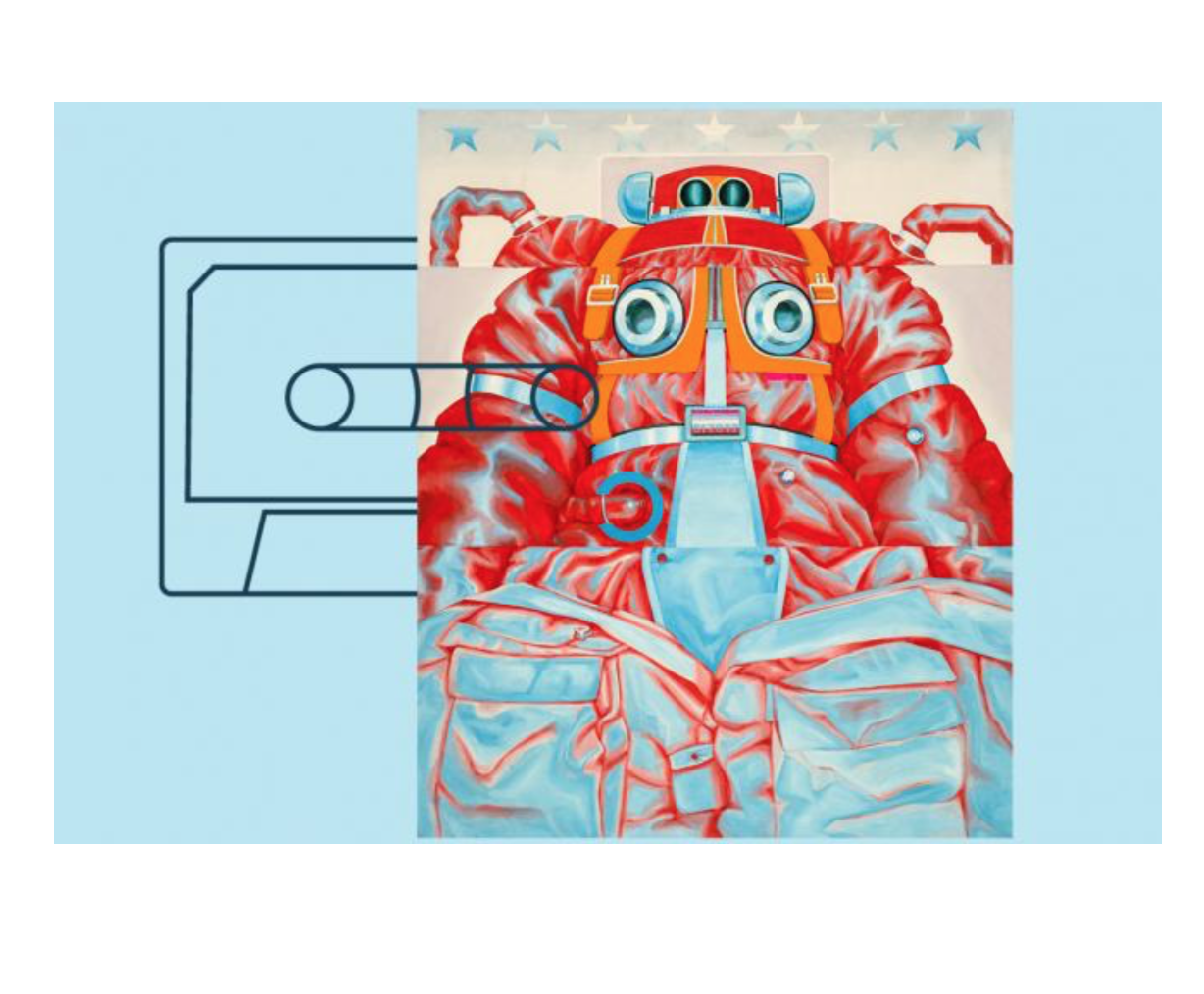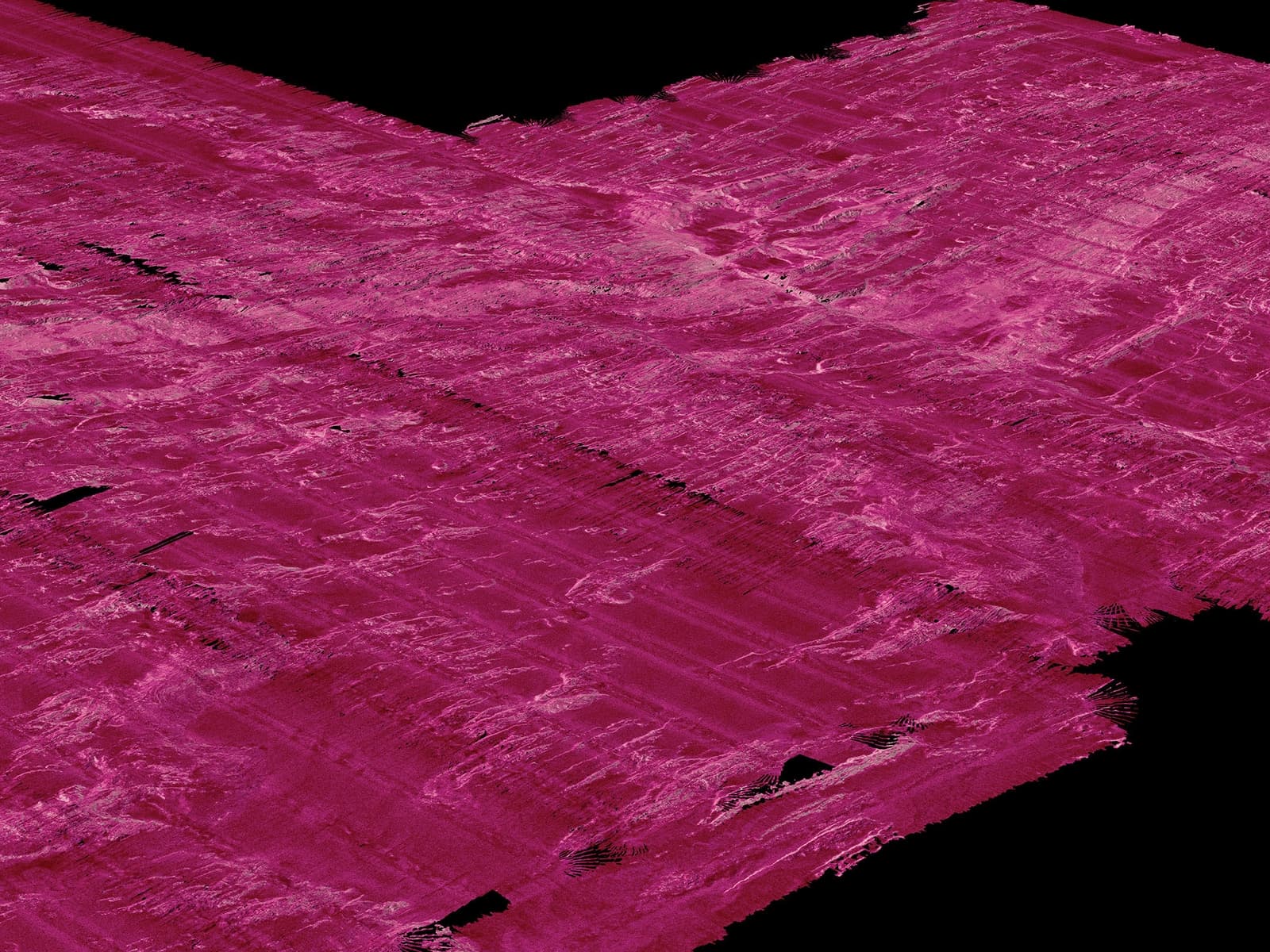| ||
| ||
 | ||
| ||
 | ||
| ||
 | ||
| ||
Eva Bunzel April 2020, und nun: Stille Von einem Tag auf den anderen werden Museen geschlossen und Veranstaltungen abgesagt. Ein digitales Angebot kann und soll den Museumsbesuch vor Ort nicht ersetzen, sondern sinnvoll erweitern. Der Medientheoretiker und Vorstand des ZKM in Karlsruhe, Peter Weibel, sieht die Zukunft der Museen in der Schaffung einzigartiger digitaler Angebote und der Beteiligung seines Publikums. Bei diesen Angeboten wird verstärkt auf interaktive, partizipative und narrative Elemente gesetzt. Das öffentliche Erleben steht im Vordergrund. Doch welche Kernaufgaben kann ein digitales Museum erfüllen, um sich als Museum bezeichnen zu können? Worin unterscheidet sich die Institution Museum künftig von anderen Räumen, die man für Veranstaltungen jeder Art mieten kann? Die Bachelorarbeit greift diese Entwicklung auf, um sich einerseits mit der Entstehungsgeschichte von Museen auseinanderzusetzen und auf der anderen Seite anhand aktueller Beispiele und ihrem Einsatz digitaler Strategien, die Rolle des Museums des 21. Jahrhunderts herauszuarbeiten. | ||
Marie Heinrichs Die Proteste in Hongkong 2019 zeichneten sich laut Medienberichten durch eine fluide, form- und führerlose Taktik aus, vor allem hervorgebracht durch Kommunikationstechnologien und das Internet. Diese Arbeit hinterfragt die aus einer digitalen Wesenhaftigkeit abgeleiteten Potenziale im Hinblick auf die Unsichtbarmachung verkörperten Protests als Mythos der Immaterialisierung, der auf eine dualistische Konzeption des Materiellen zurückgeführt wird. Die vorliegende Arbeit nimmt Braidottis Figuration der Nomadischen Subjekte als Ausgangspunkt einer Analyse digital mediatisierter Protestformen, die relationale, aktive Körperlichkeit betont. Das als politisch-ethisch kenntlich gemachte Denken fokussiert abseits von hegemonialen Grenzziehungen Potenziale verkörperter Bewegungsrelationen – Fluchtlinien. Diese Arbeit prüft und bejaht diese Potenziale entlang der Aktionen des 12. Juni 2019 der Proteste unter Einbezug der Messenger-App Telegram auf medienwissenschaftliche Anwendbarkeit. Bildquelle: https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3136819/hong-kong-police-mull-putting-2000-officers-citys-streets | ||
Lola Pfeiffer Die vorliegende Masterarbeit gibt einen Überblick über die Geschichte der Kartierung und der sich analog dazu entwickelnden Anti-Disziplin der Kritischen Kartografie. Die Karte wird mit einem kulturwissenschaftlichen Ansatz untersucht und anschließend mit Joseph Vogl (2001) medientheoretisch angeschaut. Anhand dreier ikonischer technologischer Entwicklungen seit dem 20. Jahrhundert – Satelliten, Google Maps, KI – werde ich herausarbeiten, wie das Verhältnis zwischen Karte und Landschaft gelagert ist, inwiefern die ‚Technologie‘ an der ‚Wirklichkeit‘ scheitert. Dies soll mir bei Beantwortung der Frage helfen, welche Unsicherheiten, Zweifel und Widersprüche der Technologie selbst (ebenso wie der Erde) innnewohnen. Inwiefern ließe sich eine Anerkennung dieser technologischen Unwägbarkeiten für emanzipatorische Zwecke nutzbar machen? Diese Frage werde ich durch eine Analyse zweier Counter-Maps beantworten. Ich werde mich dem gesamten Forschungsgegenstand mit einer feministischen und anti-imperialen bzw. -kolonialen Linse nähern. | ||
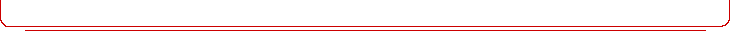 | ||